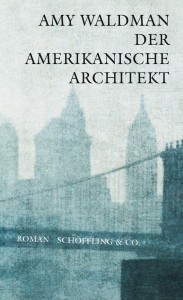Eine Frau ist weggelaufen und hat sich in New York versteckt. Dort sucht sie nach dem Mann, der womöglich ihren Ehemann ermordet hat. Ihren Ehemann, den sie gehasst hat, weil er ihr noch in der Hochzeitsnacht etwas Furchtbares angetan hat (nein, nicht das!). Ihre größte Stärke ist ihre Unscheinbarkeit. „No one paid any attention to you in the subway. Ermine or rags, it didn’t make any difference.“ Dennoch ist Lizanne Steffasson nervös, versichert sich ständig, dass sie tatsächlich nicht auffällt.
„The Cross-Eyed Bear Murders” beginnt ganz ähnlich wie „The So Blue Marble”: eine Frau ist alleine unterwegs, sie verspürt ein gewisses Unbehaugen, versichert sich aber dennoch, dass sie nicht auffallen wird und demnach sicher ist. Aber Lizanne wird nicht lange in Sicherheit bleiben. Acht Monate ist sie nun schon in New York. Das Geld geht ihr aus, sie muss etwas unternehmen. Dann glaubt sie, dem Mann näherzukommen, den sie gesucht hat – und bewirbt sich dafür auf eine geheimnisvolle Anzeige: „Wanted: A beautiful girl. One not afraid to look on danger’s bright face. Room 1000, The Lorenzo.” Sie weiß, dass sie nicht schön ist. „She was all skin and bones; she always had been thin, it wasn’t just not having enough to eat the past eight months. Her face was too tiny, and her round eyes, blue as china plates, diminished her features even more. Her eyes and her too-bright scarlet hair.“ Aber sie muss es trotzdem versuchen und wird tatsächlich von dem Anwalt Bill Folker angestellt. Er arbeitet im Auftrag von Stefan Viljaas, dem ältesten Sohn des verstorbenen, berühmt-berüchtigten finnischen Milliardärs Knut Viljaas – bekannt als „cross-eyed bear“. Dessen Erbe soll demnächst ausgezahlt werden, aber nur unter bestimmten Bedingungen:
The legacy was given in the form of a check, divided into three triangles, one for each son. This check could not be cashed until the twenty-first birthday of the youngest son, and only if the three sections were presented together. Each triangle contains not the son’s name but Old Viljaas’ seal of the cross-eyed bear. Furthermore, the check must be endorsed in triplicate with the cross-eyed bear.
Wer das Siegel bekommen hat, wissen die einzelnen Söhne nicht. Aber nicht nur das: der jüngste Bruder wird seit zwei Jahren vermisst. Bill Folker sucht nun nach dem jüngsten Sohn, bei dem auch das Siegel vermutet wird. Lizanne wiederum glaubt, dass Stefan Viljas hinter der Ermordung ihres Mannes steckt und will über den Anwalt an ihn herankommen. Allerdings gerät sie in eine Geschichte voller Gier, Verrat, Mord und Betrug, deren Ausmaße sie kaum erahnt.
In „The Crossed-Eyed Bear Murders“ verbindet Dorothy B. Hughes die Jagd nach einem Objekt – in diesem Fall ein Siegen – mit der Whodunit-Frage und einem Hauch „Women in Peril“. Vivianne begibt sich zwar freiwillig in Gefahr, in die gesamte Situation ist sie jedoch vor allem aufgrund ihrer Unschuld geraten. Nun will ist sie festen Willens, diese Unschuld abzulegen; es gelingt ihr aber nur teilweise.
Erzählerisch bleibt die Perspektive bei Lizanne, deren Informationen nicht allzu zuverlässig sind. Aber letztlich ist hier fast niemand, wer er vorgibt zu sein. Jeder hat ein eigenes Ziel. Im Vergleich zu „The So Blue Marble“ zeichnet sich ein Muster ab: Wie Griselda Satterlee ist auch Lizanne Steffasson im Grunde genommen eine Figur, die eher am Rand des Geschehens steht, das von Männern bestimmt wird. Sie ist die Sekretärin, von der einige Männer glauben, sie könnten sie manipulieren – andere wollen sie unbedingt beschützen. Ursprünglich kommt sie aus Vermont, deshalb ist sie weitaus weniger mondän als die ehemalige Schauspielerin und Kostümdesignerin Satterlee. Haupthandlungsort bleibt aber weiterhin das vornehme New York, in dem sich Folker und andere Figuren bewegen.
Schon bei den ersten beiden Büchern von Dorothy B. Hughes zeigt sich, dass ihre Frauenfiguren bemerkenswert sind, aber sie ist keine dezidiert feministische Autorin. Sowohl Griselda Satterlee als auch Lizanne Steffasson werden am Ende ein Happy End in einer Liebesbeziehung finden, auch wissen die Männerfiguren immer etwas mehr und schreiten im Zweifelsfall zur Rettung ein. Noch deutlich zeigt sich das in „The Bamboo Blonde“ – das schwächste Werk von Hughes – und vor allem in „The Blackbirder“. Dort wird der heroische Entschluss der toughen Julie Guilles, ihren Verrat zu rächen, durch die aufrichtige Liebe eines weitaus härteren Mannes nicht in die Tat umgesetzt werden. Wäre Julie ein Mann gewesen, so jedenfalls meine Vermutung, hätte er sich wohl auf den Rachefeldzug ins besetzte Frankreich begeben.
Dennoch ist diese weibliche Erzählperspektive in diesen ersten Büchern entscheidend für die große Stärke von Hughes: ihre Bücher durchzieht stets eine beeindruckende klaustrophobische Atmosphäre, sie sind besondere tale of terrors – die Protagonistinnen haben meist schreckliche Furcht, aber sie ziehen die Sache durch, egal, was passieren könnte. Ihre Furcht, ihre Anspannung überträgt sich beim Lesen mühelos, die Atmosphäre zieht regelrecht in diese Zeit hinein.
Dorothy B. Hughes: The Crossed-Eyed Bear Murders (auch: The Cross-Eyed Bear). Erstausgabe 1940.
Zu der Ausgabe:
Dank der Murder-Rooms-Reihe ist auch dieses Buch von Dorothy B. Hughes als englischsprachiges E-Book erhältlich.
Weitere Anmerkungen:
In „The Cross-Eyed Bear Murders“ taucht Inspector Tobin – bekannt aus „The So Blue Marble“ – wieder auf. Ein aufrechter New Yorker Polizist, der mit seinem Sergeant Moore Morde aufzuklären versucht, die mit der großen Geschichte in Verbindung stehen. Gelegentlich werden diese Bücher daher auch als „Inspector-Tobin-Mystery“ gehandelt. Aber das ist falsch: Tobin ist allenfalls eine Randerscheinung, zwar an der Aufklärung der Fälle beteiligt, aber alles andere als eine zentrale Figur.
Mehr zu Dorothy B. Hughes ist hier zu finden.