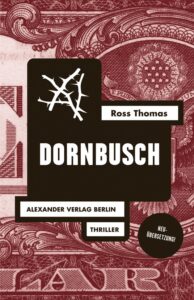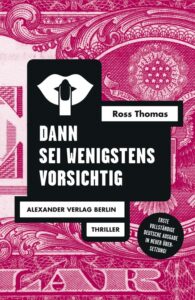Lese oder höre ich in den vergangenen Wochen Nachrichten, denke ich oft: Ich lebe nun in einem Roman von Ross Thomas. Und zwar nicht, weil seine Romane prophetisch sind. Sondern weil die Realität so absurd und zugleich real ist wie die Plots seiner Romane.
 Ein Beispiel: Im „Yellow-Dog-Kontrakt“ will eine Gruppe reicher Geschäftsleute den Ausgang der kommenden Präsidentschaftswahlen zu ihren Gunsten manipulieren. Sie versprechen sich von dem konservativen Kandidaten bessere Bedingungen für ihre Geschäfte. Es geht ihnen nicht um ein konkretes Vorhaben, vielmehr glauben sie, dass er ein besseres Umfeld schaffen würde. Also beteiligen sie sich finanziell an einem Manipulationsvorhaben, bei dem Gewerkschaften unterwandert werden, so dass Tarifverhandlungen scheitern müssen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass in den für die Demokraten wichtigsten Großstädten kurz vor der Wahl gestreikt wird. Die öffentliche Meinung würde sich gegen die Demokraten wenden, der konservative Kandidat wird gestärkt. Eine raffinierte Manipulation, von außen nur schwer zu durchschauen.
Ein Beispiel: Im „Yellow-Dog-Kontrakt“ will eine Gruppe reicher Geschäftsleute den Ausgang der kommenden Präsidentschaftswahlen zu ihren Gunsten manipulieren. Sie versprechen sich von dem konservativen Kandidaten bessere Bedingungen für ihre Geschäfte. Es geht ihnen nicht um ein konkretes Vorhaben, vielmehr glauben sie, dass er ein besseres Umfeld schaffen würde. Also beteiligen sie sich finanziell an einem Manipulationsvorhaben, bei dem Gewerkschaften unterwandert werden, so dass Tarifverhandlungen scheitern müssen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass in den für die Demokraten wichtigsten Großstädten kurz vor der Wahl gestreikt wird. Die öffentliche Meinung würde sich gegen die Demokraten wenden, der konservative Kandidat wird gestärkt. Eine raffinierte Manipulation, von außen nur schwer zu durchschauen.
„Der Yellow-Dog-Kontrakt“ ist 1976 erschienen, damals waren Gewerkschaften sehr relevant. Sie waren Machtfaktoren. Ersetzt man nun Gewerkschaften und Streik mit sozialen Netzwerken und Algorithmen, muss man nicht lange suchen, um Parallelen in die Gegenwart zu finden. Mitsamt einer Gruppe sehr reicher Geschäftsleute, die ein Interesse daran haben, dass das politische Klima so ist wie es ist.
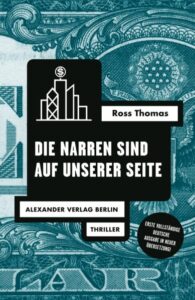 Ein zweites Beispiel: In „Die Narren sind auf unserer Seite“ erfahren Geschäftsleute, dass in einer Stadt im Süden der USA bald sehr viel Geld zu verdienen ist. Also wollen sie die Stadt unter sich aufteilen. Mit anderen Worten: Sie wollen die Stadt in ihren Besitz bringen, um Geld zu verdienen. Das geschieht auf verschiedenen Wegen: Sie setzen Menschen unter Druck und bedrohen sie, damit sie die Stadt verlassen. Sie kaufen Stimmen in Gremien und wichtige Unterstützer – entweder direkt mit Geld oder über Versprechungen, bestimmte Vorhaben zu finanzieren. Vor allem manipulieren sie die öffentliche Meinung, indem sie Gruppierungen aufeinanderhetzen, Halbwahrheiten oder einfach Lügen verbreiten. Ersetzt man nun „Stadt im Süden“ mit Venezuela oder Grönland, ist man mitten in der Realität.
Ein zweites Beispiel: In „Die Narren sind auf unserer Seite“ erfahren Geschäftsleute, dass in einer Stadt im Süden der USA bald sehr viel Geld zu verdienen ist. Also wollen sie die Stadt unter sich aufteilen. Mit anderen Worten: Sie wollen die Stadt in ihren Besitz bringen, um Geld zu verdienen. Das geschieht auf verschiedenen Wegen: Sie setzen Menschen unter Druck und bedrohen sie, damit sie die Stadt verlassen. Sie kaufen Stimmen in Gremien und wichtige Unterstützer – entweder direkt mit Geld oder über Versprechungen, bestimmte Vorhaben zu finanzieren. Vor allem manipulieren sie die öffentliche Meinung, indem sie Gruppierungen aufeinanderhetzen, Halbwahrheiten oder einfach Lügen verbreiten. Ersetzt man nun „Stadt im Süden“ mit Venezuela oder Grönland, ist man mitten in der Realität.
Das sind nur zwei Beispiele, in jedem Ross-Thomas-Roman steht etwas, das mir etwas über die Gegenwart erzählt. Das Politik nur die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln ist, beispielsweise. Trumps Mittel sind Zölle. Oder dass jede Regierung spätestens ein Jahr nach der Wahl in der Scheiße steckt und verzweifelt einen Skandal sucht, den sie auf die Vorgängerregierung schieben kann, um von ihrem Versagen abzulenken.
 Seine Romane haben meinen Blick auf die Realität geändert, ihn geschärft. Sie sind Lehrstücke – schwer unterhaltsame, sehr komische Lehrstücke – darüber, wie Sprache eingesetzt wird, um Wahrheiten zu verschleiern oder falsche Informationen in die Welt zu setzen. In Romanen wie „Stimmenfang“ oder „Der Mordida-Man“ lernt man so einfache Grundsätze wie: Ein Gerücht kann man nicht bestreiten, ohne ihm Glaubwürdigkeit zu verleihen. Es setzt sich dann fest in den Köpfen. Und daran sollten wir heutzutage jeden Tag denken. Gerüchte sind Machtfaktoren.
Seine Romane haben meinen Blick auf die Realität geändert, ihn geschärft. Sie sind Lehrstücke – schwer unterhaltsame, sehr komische Lehrstücke – darüber, wie Sprache eingesetzt wird, um Wahrheiten zu verschleiern oder falsche Informationen in die Welt zu setzen. In Romanen wie „Stimmenfang“ oder „Der Mordida-Man“ lernt man so einfache Grundsätze wie: Ein Gerücht kann man nicht bestreiten, ohne ihm Glaubwürdigkeit zu verleihen. Es setzt sich dann fest in den Köpfen. Und daran sollten wir heutzutage jeden Tag denken. Gerüchte sind Machtfaktoren.
Es geht immer ums Geld
Ross Thomas bricht komplexe Sachverhalte auf einfache Handlungsmotive herunter. Er geht davon aus, dass Menschen immer einen Grund haben zu handeln wie sie es tun – und dieser Grund ist in der Regel Geld. Manchmal gepaart mit Macht. Aber auch die ist oft nur interessant, um mehr Geld zu verdienen. Und dazu reicht meistens eine gewisse Nähe zur Macht. Machen Politiker etwas, was viele als moralisch gut bezeichnen würden, macht sie das, weil sie davon profitieren. Das macht sie nicht zu schlechten Menschen. Das macht sie berechenbar. In dem Nachwort zu „Die im Dunkeln“ schreibt der Übersetzer Gisbert Haefs so schön, dass die Annahme, irgend jemand auf verantwortlichem Posten sei möglicherweise nicht korrupt, bei Ross Thomas allenfalls ein schlechter Witz ist. Denn Ross Thomas weiß, dass die meisten Menschen am empfindlichsten sind, wenn es um Geld geht – und das macht sie beeinflussbar.
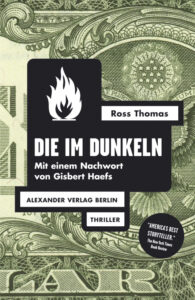 Den alten Leitsatz „Follow the money“ kennt man aus zahlreichen Kriminalromanen und -serien. Aber er geht davon aus, dass es schon Geld gibt, dem man folgen kann. Bei Ross Thomas geschieht hingegen manchmal auch etwas, damit man zukünftig mehr Geld verdienen kann. Deshalb sind Wahlkämpfe so wichtig. In ihnen wird entschieden, wer künftig über Geld entscheiden kann. Sie werden aber wiederum selbst mit Geld. In „Die im Dunkeln“ lernt man fast alles, was man über Wahlkampffinanzierung jemals wissen wollte. Mit Geld kauft man Werbung. Man kauft Unterstützer. Man kauft im Zweifelsfall Stimmen.
Den alten Leitsatz „Follow the money“ kennt man aus zahlreichen Kriminalromanen und -serien. Aber er geht davon aus, dass es schon Geld gibt, dem man folgen kann. Bei Ross Thomas geschieht hingegen manchmal auch etwas, damit man zukünftig mehr Geld verdienen kann. Deshalb sind Wahlkämpfe so wichtig. In ihnen wird entschieden, wer künftig über Geld entscheiden kann. Sie werden aber wiederum selbst mit Geld. In „Die im Dunkeln“ lernt man fast alles, was man über Wahlkampffinanzierung jemals wissen wollte. Mit Geld kauft man Werbung. Man kauft Unterstützer. Man kauft im Zweifelsfall Stimmen.
Das steckt hinter Donald Trumps Drohung an beispielsweise abtrünnige Republikaner: Wenn er sagt, er unterstützt sie nicht mehr, heißt das, er sorgt dafür, dass sie kein Geld von der Partei mehr bekommen. Und ohne Geld lässt sich kein Wahlkampf in den USA gewinnen.
Davon hat schon die liberale Serie „The West Wing“ erzählt – auch der gute, demokratische Präsident Bartlett hat Kandidaten Geld entzogen. Ohnehin ist nichts davon, was gerade passiert, im Kern der Sache neu. Aber nur wenige schauen genau hin. Die meisten sind unglaublich geschichtsvergessen. Ich bin immer wieder erstaunt: Wie kann man nach der Iran-Contra-Affäre noch von irgendetwas überrascht sein? Wie schnell kann so ein Skandal in Vergessenheit geraten?
Ausgestellte Schamlosigkeit
 Neu ist etwas anderes: Bei Ross Thomas geschehen die Schmierereien, die Schurkenstücke noch im Verborgenen. Die Öffentlichkeit ist empört, wenn herauskommt, was die CIA in Lateinamerika macht. Menschen in verantwortlichen Positionen wollen Dinge vertuschen, sie wollen zumindest den Schein aufrechterhalten. Donald Trump macht öffentlich keinen Hehl aus seiner Schamlosigkeit, seine Gier. Und offenbar ist sein Verhalten für viele Menschen in Ordnung. Aber dennoch schiebt er Gründe für sein Interesse an Grönland und Venezuela vor.
Neu ist etwas anderes: Bei Ross Thomas geschehen die Schmierereien, die Schurkenstücke noch im Verborgenen. Die Öffentlichkeit ist empört, wenn herauskommt, was die CIA in Lateinamerika macht. Menschen in verantwortlichen Positionen wollen Dinge vertuschen, sie wollen zumindest den Schein aufrechterhalten. Donald Trump macht öffentlich keinen Hehl aus seiner Schamlosigkeit, seine Gier. Und offenbar ist sein Verhalten für viele Menschen in Ordnung. Aber dennoch schiebt er Gründe für sein Interesse an Grönland und Venezuela vor.
Bei Ross Thomas kennen Politiker zumindest öffentlich noch etwas Scham. Sie gaukeln Moral vor. Es sind nicht die Menschen in der ersten Reihe, die sich die Hände schmutzig machen. Die Fäden ziehen Hintermänner. Die in den „Schattenzonen“ (Kälter als der Kalte Krieg), diejenigen in der zweiten Reihe, bei denen vieles zusammenläuft. Politiker sind bei Ross Thomas nicht die cleversten Menschen. Im Gegenteil, überdurchschnittliche Intelligenz wird mehrfach als hinderlich für eine politische Karriere beschrieben. Sie sind deshalb aber auch keine Marionetten, sondern: arrogante, oft privilegiert aufgewachsenen Männer, die entweder durch ihre eigene Familie oder eine Ehe an Geld gekommen sind, dann einen Posten bekommen haben – und nun glauben, sie kommen mit allem durch. Weil es ihnen zusteht. Diese Haltung findet man gerade überall.
Und sogar diese Veränderung kann ich mir mit Ross Thomas erklären: Demokratie ist bei ihm nie eine überlegene Ideologie. Sie ist die Regierungsform, in der der Kapitalismus am besten gedeihen kann. Seit Ross Thomas‘ Tod 1995 hat der Kapitalismus noch zugelegt – und damit auch die Gier, die Überzeugung, alles und jeder ist käuflich. Dass Geld das Einzige ist, was zählt, hat sich offenbar als Überzeugung bei vielen durchgesetzt. Reiche Menschen sind bei Ross Thomas immer suspekt. Heutzutage stellen viele sehr reiche Menschen ihren Reichtum schamlos aus und werden dafür bewundert. Warum also sollten sie noch glauben, dass sie sich an Regeln halten müssen?
Das alles mag unglaublich ernüchternd klingen, aber bei mir wirken die Romane anders: Ross Thomas blickt völlig illusionslos auf Politik. Nicht desillusioniert oder zynisch – diese Unterscheidung ist wichtig. Denn in der Gegenwart ist Zynismus der einfache Weg. Wir brauchen mehr Durchblick. Und den findet man mithilfe von Ross Thomas‘ Romanen. Außerdem gibt es bei Ross Thomas immer auch die Figuren, die den Schlamassel entwirren, die größte Unbill verhindern. Am Ende ist nicht alles gut, das wäre naiv. Aber es gibt Hoffnung, dass sich manches ändern kann.