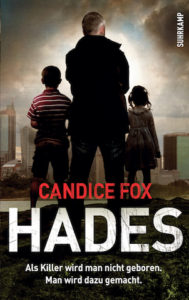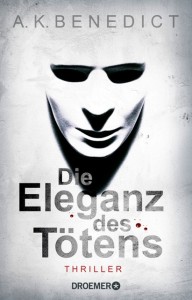Ein zeitreisender Serienkiller ist eine Idee, die mir bereits in Lauren Beukes „Shining Girls“ gut gefallen hat. Sie entwickelt diese Geschichte hauptsächlich aus zwei Perspektiven: der jungen Frau Kvirby, die einen Angriff überlebte und ihn seither jagt, und dem Täter selbst, der durch die Jahrzehnte springt, sich seine Opfer bereits als Kinder aussucht und erst Jahre später ermordet. Als Vehikel seiner Zeitreisen dient ihm ein mysteriöses Haus – und während mir diese Erklärung völlig ausreichte, wurde u.a. von My Crime Time kritisiert, dass das Zeitreisen nicht genügend erklärt wurde. Als ich nun in der Verlagsankündigung von DroemerKnaur A.K. Benedicts „Die Eleganz des Tötens“ entdeckte, war ich sofort neugierig: Wie würde sie ihr Buch aufbauen – und wie würde sie mit dem Aspekt des Zeitreisens umgehen?
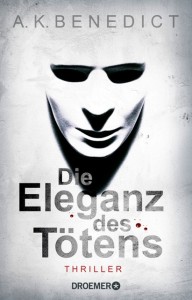
(c) Droemer
Sowohl die Handlung als auch die Erzählweise unterscheiden sich sehr von Lauren Beukes: Alleinige Hauptfigur in „Die Eleganz des Tötens“ ist der frischgebackene Philosophiedozent Stephen Killigan, der gerade in Cambridge angefangen hat. Er hat eine Sammelleidenschaft, ist leicht zerstreut und seit dem Selbstmord seiner Mutter traumatisiert. Eines Abends entdeckt er im betrunkenen Zustand die Leiche einer seit einem Jahr vermissten Schönheitskönigin und verständigt die Polizei. Als sie jedoch am Tatort eintrifft, fehlt von der Leiche jegliche Spur. Daraufhin gerät er selbst ins Visier der Ermittlungen, zugleich aber interessiert sich plötzlich sein Kollege Robert Sachs für ihn. Durch ihn erfährt er mehr über eine Maske, die die Tote getragen hat, außerdem forscht er mithilfe der hübschen Bibliothekarin Lana weiter nach und hat schon bald die Idee, dass der Mörder durch die Zeiten reisen könnte.
Eine Erklärung für die Zeitreisen findet A.K. Benedict in Ansätzen schon: Man muss sich in einen möglichst losgelösten Zustand bewegen – aus dem Denken ins das Fühlen: „Genau dann, wenn wir am lebendigsten, ehrlichsten und am verletzlichsten sind, können wir den Raum zwischen konstruierten Realitäten ausmachen und durch die Lücken treten“, erfährt Killigan durch eine erfahrene Zeitreisende, als er entdeckt, dass auch er durch die Zeit reisen kann, wenngleich ihm noch einige Fertigkeiten wie das Treffen des korrekten Datums fehlen. Dadurch ist er in der Lage, den Plan des Mörders nach und nach zu enthüllen, zugleich aber deutet sich schon früh an, dass dieser ihm an Raffinesse und Erfahrung zu überlegen ist als dass er ihn fassen könnte. Damit weicht A. K. Benedict wie schon Lauren Beukes eine schwierigen Frage aus – wie fasst man einen Mörder, der durch die Zeiten reist? –, legt aber bereits den Grundstein der Antwort, indem der Ermittler ebenfalls ein Zeitreisender ist.
Insgesamt aber geht es A. K. Benedict in ihrem Buch um die titelgebende ‚Eleganz des Tötens’, der sowohl der Killer als auch Killigans Kollege Robert Sachs verfallen sind. Daneben werden einige philosophische Themen angesprochen, allerdings bleibt sie meist an der Oberfläche, anstatt sich auf den naheliegenden – und am Ende auch thematisierte – Konflikt zwischen Determinismus und freiem Willen zu konzentrieren. Ohnehin ist der Thriller insgesamt zu lang und weitschweifend: Weniger Betonungen des Offensichtlichen und unnötige Nebenhandlungen wie beispielsweise das pubertäre und unreife Versprechen, sich mit einer Frau nicht zu verabreden, die der beste Freund seit vier Jahren aus der Ferne bewundert, obwohl er sich ebenfalls in sie verliebt hat, hätten sowohl dem Spannungsaufbau als auch dem Lesefluss gut getan. Vor allem aber beschreibt sie zu viel – jedoch macht eine Aneinanderreihung von Eigenschaften aus einer Figur noch keinen Charakter, schaffen viele Details in der Einrichtung und dem Wetter noch keine Atmosphäre und sind viele philosophische Themen nicht gleichbedeutend mit Tiefsinn. Hier fehlen Stringenz und das Gespür für Wichtiges. Allerdings erklärt sich dann immerhin das Bemühen, auch der Polizistin Jane Horne mit ihrer Krebserkrankung eigenes Profil zu verleihen, als am Ende deutlich wird, dass es wohl eine Fortsetzung mit Killigan und Inspector Jane Horne geben wird, bei dem sie weiterhin versuchen, in der Vergangenheit liegende Fälle aufzuklären – und den genialen Zeitreise-Supermörder zu jagen. Auf dieses Wiedersehen werde ich allerdings verzichten.
A.K. Benedict: Die Eleganz des Tötens. Aus dem Englischen von Alice Jakubeit. Droemer 2014.