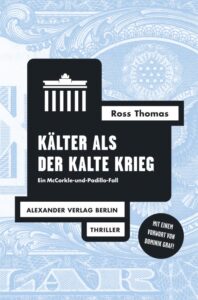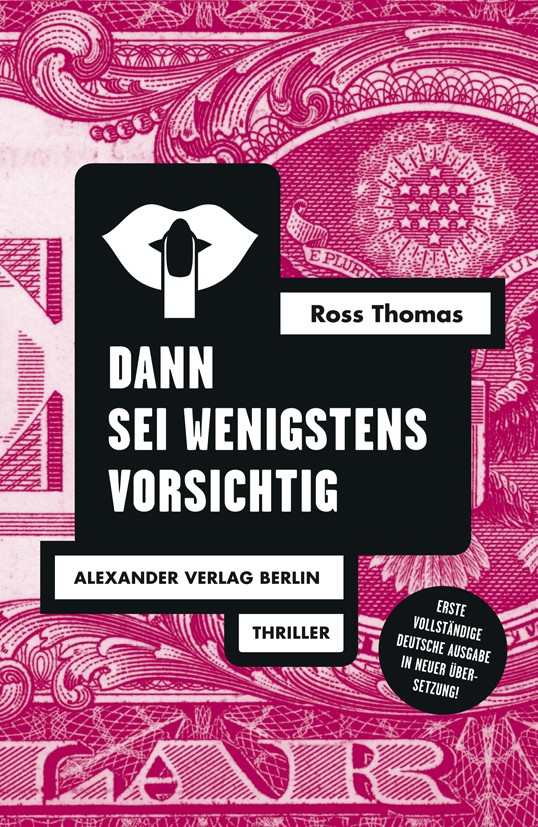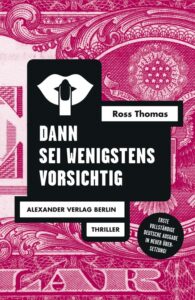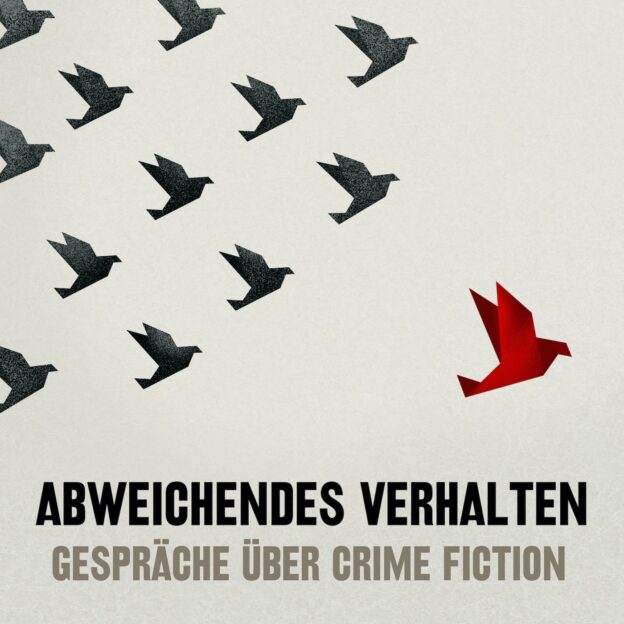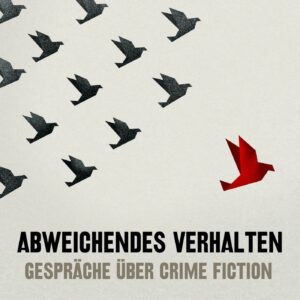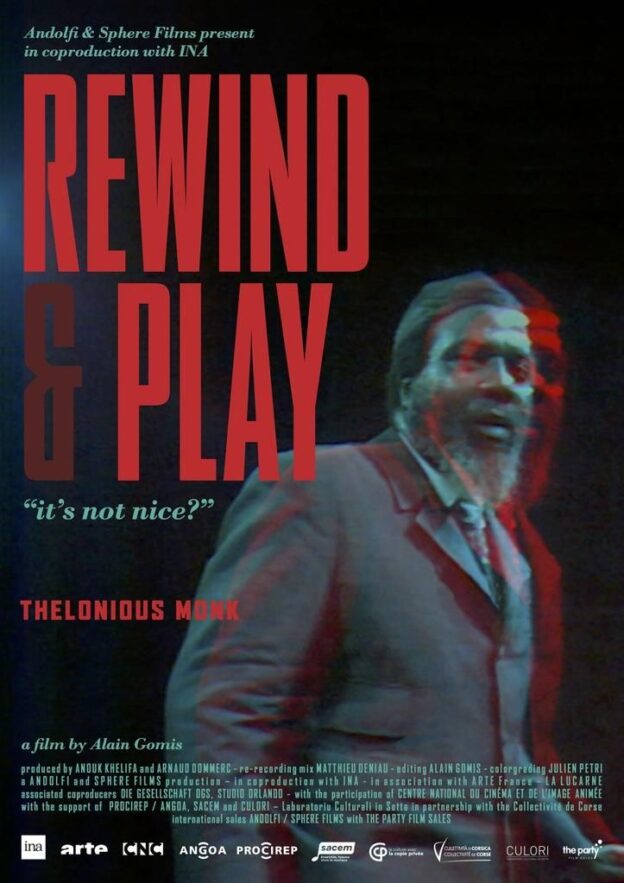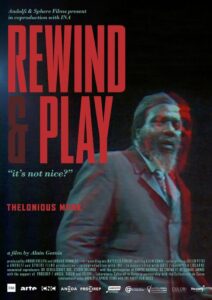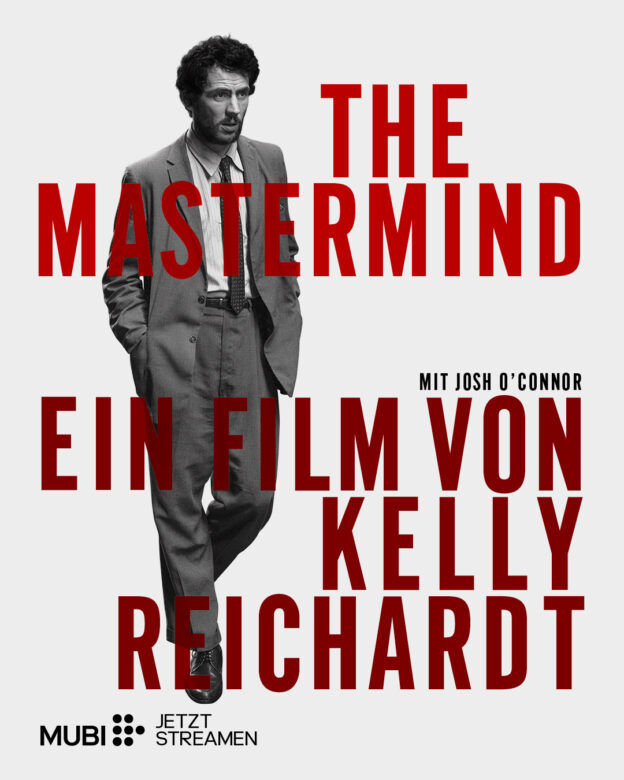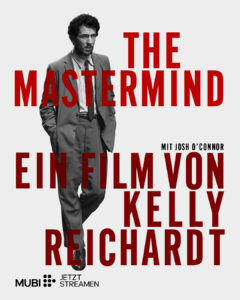Voriges Jahr habe ich zum Abschluss der Ross-Thomas-Werkausgabe im Alexander Verlag einen längeren Beitrag für das SWR-Lesenswert-Magazin gemacht. Damals fragte mich die Moderatorin Katharina Borchardt, ob ich eigentlich alle Romane gelesen hätte. Und ich musste sagen: nein. Fast alle. Aber nicht alle. Das sollte mir nicht noch einmal passieren! Ich beschloss: Ich lese mich (größtenteils nochmals) vollständig durch das Werk von Ross Thomas. Eigentlich wollte ich zu seinem 100. Geburtstag am 19. Februar nicht nur mit dem Werk durch sein, sondern auch sortierter in meinen Gedanken. Ich habe unzählige Ideen, was ich alles schreiben, machen, tun könnte. Aber das Leben, ein Serienkiller-Feature und sonstige Arbeit kamen dazwischen – und daher habe ich für die Februar-Ausgabe des CrimeMag ein Zwischenfazit gezogen.
**
Biographie
In vielen Ross-Thomas-Figuren steckt etwas aus seiner Biographie, seinen Erfahrungen in Deutschland, auf den Philippinen oder in Nigeria. Das merkt man an Kleinigkeiten – so hat der Erzähler aus dem „Yellow-Dog-Contract“ beim Radio in Westdeutschland gearbeitet hat –, vor allem aber den Beschreibungen der Orte und natürlich der Plots. Ross Thomas weiß, wovon er erzählt – aber er hat keine „Insider-Pose“ oder will damit angeben.
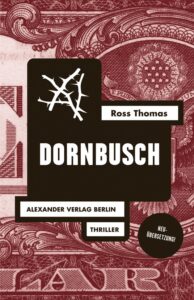 Durch seine Erfahrungen hat er – und haben viele seiner Figuren – keine Illusionen über den Zustand der Welt. Er ist – wie der Historiker Deke Lucas aus „Dann sei wenigstens vorsichtig“ jemand, der die Ereignisse beobachte. Ein „politische Agnostiker“ wie Ben Dill , der „schon vor langer Zeit die Hoffnung aufgegeben (hatte), daß es irgendetwas gab, gegen das irgend jemand irgendwas unternehmen könnte, doch diejenigen, die noch immer daran glaubten, interessierten ihn, und er fand, daß die meisten von ihnen amüsante Gesellschaft und geistreiche Gesprächspartner waren.“ („Dornbusch“)
Durch seine Erfahrungen hat er – und haben viele seiner Figuren – keine Illusionen über den Zustand der Welt. Er ist – wie der Historiker Deke Lucas aus „Dann sei wenigstens vorsichtig“ jemand, der die Ereignisse beobachte. Ein „politische Agnostiker“ wie Ben Dill , der „schon vor langer Zeit die Hoffnung aufgegeben (hatte), daß es irgendetwas gab, gegen das irgend jemand irgendwas unternehmen könnte, doch diejenigen, die noch immer daran glaubten, interessierten ihn, und er fand, daß die meisten von ihnen amüsante Gesellschaft und geistreiche Gesprächspartner waren.“ („Dornbusch“)
**
Chronologie
Ursprünglich wollte ich mich strikt chronologisch durch das Werk lesen, dass habe ich nicht ganz durchgehalten. Auch lese ich die St. Ives-Romane komplett zum Schluss. Doch chronologisches Lesen ermöglicht manche kleine Entdeckungen. Zum Beispiel: „Kälter als der Kalter Krieg“ endet mit:
„Der Besitzer hat einmal eine Postkarte aus Dahomey in Westafrika erhalten. Es stand nur „Well“ darauf, und sie war mit einem „P.“ unterzeichnet. Seither erscheint in der Londoner Times jeden Dienstag unter „Persönliches“ die gleiche Anzeige. Sie lautet: Mike: Alles vergeben. Komm nach Hause. Die Weihnachtshilfe.“
In „Stimmenfang“ nun treffen die Hauptfiguren in einem Lokal in dem fiktiven westafrikanischen Staat, in dem der Roman spielt, auf einen Mike. Ihm gehört das Lokal nicht, er „hilft einem Freund aus“. Vor allem aber:
„(D)er Mann namens Mike ging zurück hinter die Bar, griff nach einem Exemplar der Londoner Times und lächelte über die Kontaktanzeigen.“
Ein Cameo-Auftritt von Mike Padillo! In „Gelbe Schatten“ referenziert er dann diese Tätigkeit. Ich habe mal gelesen (oder gehört), dass Ross Thomas anfangs durchaus darüber nachdachte, eine Reihe mit McCorkle und Padillo zu schreiben – und das wäre ein weiterer Hinweis darauf. Denn „Stimmenfang“ ist wie „Gelbe Schatten“ (der zweite McCorkle-Padillo-Roman) im Jahr 1967 erschienen.
Es gibt noch andere Cameo-Auftritte von Figuren. Chubb Dunjee aus dem „Mordida-Mann“ wird in „Voodoo Ltd.“ erwähnt, offenbar haben Artie Wu und Quincy Durant ihn mal in Mexiko getroffen. Und wir wissen, was er dort getan hat … In „Die im Dunkeln“ tauchen einige Figuren am Rande wieder auf, sie werden in den Anmerkungen des Übersetzers Gisbert Haefs auch aufgeschlüsselt. (Das Buch hat auch ein sehr lesenswertes Nachwort von ihm!). Weiterlesen