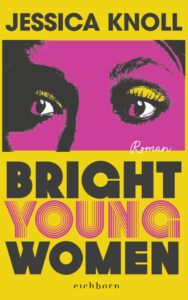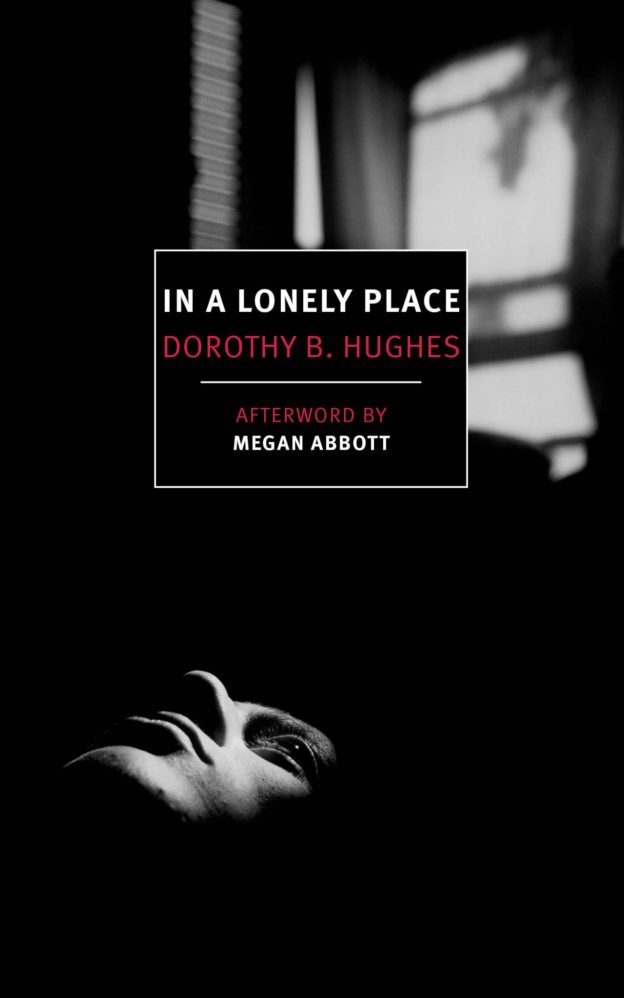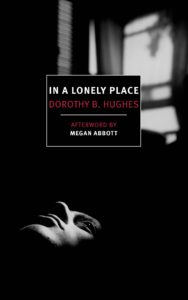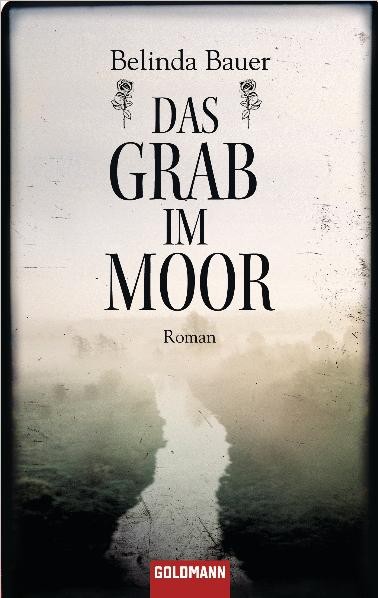Sein Name wird im Buch nicht genannt. Eine bewusste Entscheidung, betont die Autorin Jessica Knoll. Zu viel wurde bereits über ihn erzählt. Zu bekannt ist er, der Täter, im Gegensatz zu seinen Opfern. Allein: Auf dem Buchumschlag steht sein Name. Der Paratext stellt sicher, was der Text nicht tut: Dass wirklich jede*r Leser*in weiß, dass der Täter, der im Roman „der Angeklagte“ genannt wird, Ted Bundy ist. Wobei: Kann man wirklich davon ausgehen, dass nicht sowieso klar ist, um wen es geht? Der ‚berühmteste Serienkiller der USA‘ hat eine seit Jahrzehnten andauernde mediale Präsenz. Jede Generation „ihre“ Ted-Bundy-Geschichte. Ist die Idee, den Namen nicht zu nennen, nur ein Marketing-Aufhänger? Oder freundlicher formuliert: Ein gutgemeinter Gedanke, der nicht ganz zu Ende gedacht ist? Und: Funktioniert das Buch überhaupt, wenn man die Geschichte von Ted Bundy nicht kennt?
Ohne diese Folie ist „Bright Young Women“ ein leidlicher spannender Roman. Jessica Knoll erzählt hauptsächlich aus zwei Perspektiven, deren Stimmen sich kaum unterscheiden: Pamela, eine Studentin, die nur durch Glück überlebt, als „der Angeklagte“ im Januar 1978 in ein Studentinnenwohnheim in Floria eindringt, und zur Hauptzeugin gegen ihn wird. Dazu kommt Ruth, eine junge Frau, die ihre unglückliche Ehe hinter sich gelassen hat. Sie besucht eine Selbsthilfegruppe, lernt emanzipierte Frauen kennen und beginnt, sich von ihrer übergriffigen Familie – vor allem ihrer Mutter – zu lösen. Bis sie an einem Sommertag eine fatale Entscheidung trifft.
In diesen Geschichten erzählt Knoll viel über die alltägliche Misogynie der 1970er Jahre – und darin steckt auch eine Erinnerung daran, dass wir in der Gegenwart – allem Backlash zum Trotz – weitergekommen sind. Spannung stellt sich indes kaum ein. Das liegt vor allem daran, dass sie von Knoll lediglich durch redundante Vorausdeutungen und Cliffhanger aufgebaut wird – und die ersten zwei Drittel des Buchs viel zu langatmig sind.
Erst im letzten Drittel zeigt sich das Potential der Geschichte. Hier konzentriert sich Knoll auf die Frauenfeindlichkeit innerhalb der Justiz, der Polizei und letztlich auch der medialen Berichterstattung. Genau dann aber zeigt sich abermals: Selbst falls Knoll tatsächlich Bundy den medialen Nachruhm verweigern wollte, profitiert sie von genau dem medialen Hype, den sie kritisiert.
Keine Besprechung kommt ohne den Verweis auf. Schon der Titel spielt auf den berühmt-berüchtigten Urteilsspruch gegen Bundy an. Die Namen der Opfer stimmen überein. Nicht alle, aber viele. Sogar die vermeintlich fiktionale Perspektive hat ein reales Vorbild. Was aber Fakt, was Fiktion ist, wird nicht kenntlich gemacht. Wie gut man es erkennt, liegt am Wissen über Bundy – und seinen medialen Nachruhm. Warum aber dieses Spiel? Warum nicht eine rein fiktionalisierte Version schreiben?
Knoll betont: Ted Bundy war eben nicht der „bright young man“ als den ihn der Richter betitelte. Ihre Argumente? Vor allem der formale Bildungsgrad Bundys. Dieser klassistische Hauch schmälert die beste These des Buches: Dass es nicht die Genialität der Täter ist, die Serienmörder so schwer zu fassen macht. Sondern die Unfähigkeit der Ermittlungsbehörden. Im Falle Bundys – und vieler anderer Täter – geprägt von der Misogynie der Ermittler. Dafür aber hätte sie mehr Argumente gebraucht.
Jessica Knoll: Bright Young Women. Aus dem Englischen von Jasmin Humburg. Eichborn 2024. 461 Seiten. 18 Euro.