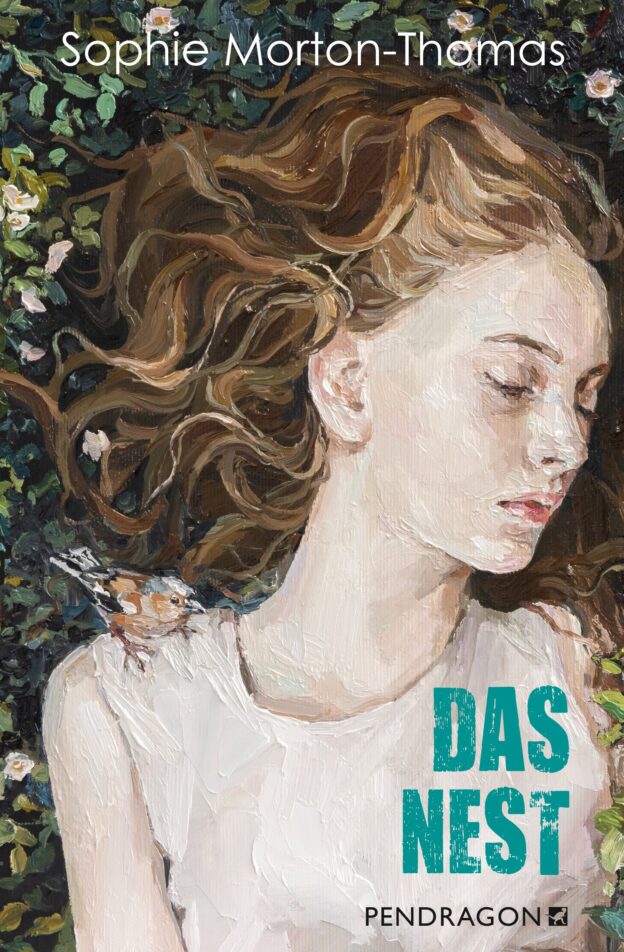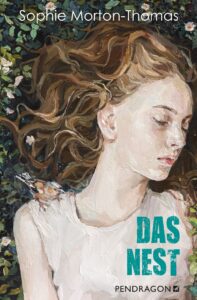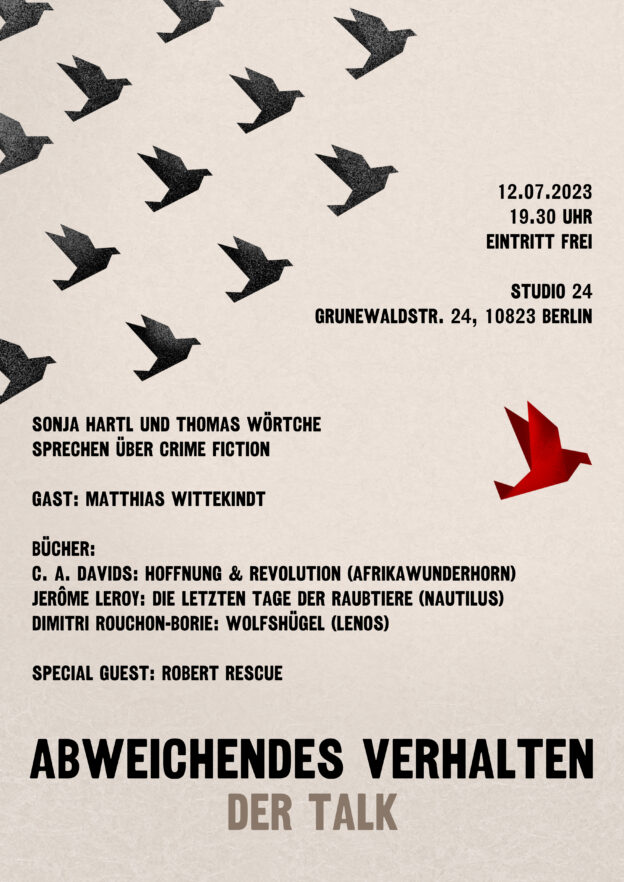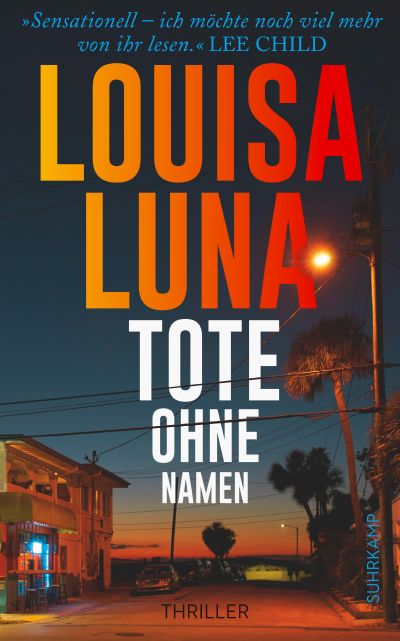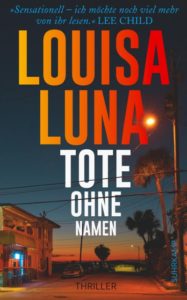Am Anfang ein Geständnis: Ich habe alle Folgen von Inspector Lewis gesehen. Mehrfach. Nicht weil ich sie für herausragendes Fernsehen halte. Aber sie boten mir ein bisschen Eskapismus mit Mord. Gefühlt war zu 75 Prozent immer eine Frau die Täterin – aber sogar darüber konnte ich lachen. Ich war noch nie in Oxford, aber ich stelle es mir wie ein elitäres Disneyland vor, in dem man an jeder Ecke über schlaksige, blasse junge Männer stolpert, die Keats zitieren oder Tolkien erklären.
Die Serie hat aber auch ein gewisses Interesse für Oxford-Krimis geweckt – und ich mochte Cara Hunters Reihe recht gerne. Deshalb war ich sehr gespannt auf Simon Masons „Mord im November“. Die Grundkonstellation ist: DI Ray Wilkins und DI Ryan Wilkins müssen einen Mordfall aufklären. Ja, sie heißen wirklich so, ich habe mich nicht vertippt. Ray Wilkins ist gebildet, kultiviert, Oxford-Absolvent, charmant, gutaussehend, mit vollendeten Manieren ausgestattet und Schwarz. Ryan Wilkins sieht aus wie ein Teenager, kommt mit Joggingshose und Basecap zum Dienst, ist in einer Trailersiedlung in Oxford in einer kaputten Familie aufgewachsen, hat ein ausgeprägtes Aggressionsproblem und ist weiß.
Das soll vermutlich witzig sein, aber von Anfang an hatte ich Unbehagen. Denn: Setzt diese Konstellation voller Gegensätze setzt nicht auch voraus, dass es weiterhin „überraschend“ ist, wenn ein Schwarzer kultiviert und Oxford-Absolvent ist? Und als ich den Kriminalroman dann las, hatte ich recht schnell den Gedanken: Wäre Ryan schwarz, wäre er schon längst im Gefängnis. Niemand würde es ihm dieses Verhalten durchgehen lassen, egal, welche Ermittlerfähigkeiten er hätte. Denn natürlich ist der Proll der Geniale in dieser Kombination. Vermutlich als lustiger Take auf die Morses und Lewis‘ gedacht, wo immer der Kultivierte auch der Cleverere war, ist das einfach nicht zu Ende gedacht. Und auch als Kommentar auf den Klassismus und Rassismus der britischen Gesellschaft ist greift es zu kurz.
Aber Mason vertraut voll auf diese Grundidee, denn der Kriminalfall hätte auch in einer Inspector-Lewis-Folge erzählt werden können: Es gab ein Mord im altehrwürdigen Barnabas College. Im Büro des Provost wird eine Frau (natürlich) aufgefunden. Im Folgenden gibt es das übliche Figuren-Arsenal: einen seltsamen Pförtner, einen egozentrischen Gelehrten usw. Außerdem einen reichen arabischen Mann, der möglicherweise Geld für das College bedeutet. Das ist mit das Interessanteste an diesem Buch: Oxford wird hier nämlich als internationaler Standort gezeigt, der längst von ausländischen Investitionen und Studierenden abhängt. Alles andere aber ist Oxford-Krimi-Standardware.
Simon Mason: Ein Mord im November. Übersetzt von Sabine Roth. Goldmann Verlag 2025. 396 Seiten. 17 Euro.