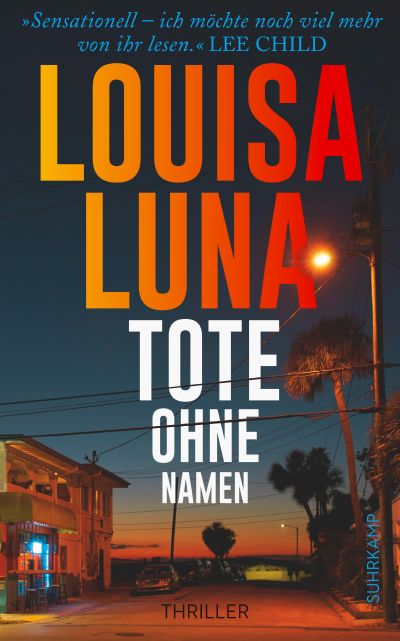Vor kurzem habe ich noch geschrieben, dass ich fast nur noch gucke, was ich gucken will. Und dieses Wochenende habe ich mich um das „fast“ in diesem Satz gekümmert. Denn natürlich gibt es Filme, die ich nach meinem Empfinden gucken sollte/müsste, weil sie direkt in mein Arbeitsgebiet fallen. Mit solchen Filmen ist es bei mir oft so: Ich schiebe sie jahrelang vor mir her, dadurch werden sie gefühlt unglaublich groß – und wenn ich mich dann endlich aufraffe, sie zu gucken, stelle ich erstaunt fest, dass es ja doch nur ein Film ist. (Hier ließe sich auch problemlos das Wort Film durch Buch ersetzen).
Dieses Wochenende habe ich nun endlich „Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile“ geguckt. Kurz zusammengefasst: Der Ted-Bundy-Film mit Zac Efron. Ähnlich wie „Bright Young Women“ setzt der Film einerseits darauf, dass man weiß, wer Ted Bundy war – und versucht andererseits Spannung mit seiner Geschichte aufzubauen.
Der Film lehnt sich an das Buch von Elizabeth Kendall an, die jahrelang mit Ted Bundy eine Beziehung hatte. Gleich zu Anfang des Films begegnen sie einander in einer Bar. Er mag sie, obwohl Liz (Lily Collins) eine alleinerziehende Mutter ist. Sie verbringen bald Weihnachten miteinander, sind in diesem schnellen Zusammenschnitt ein auf den ersten Blick glückliches und normales Paar. Doch dann wird Ted Bundy bei einer Verkehrskontrolle angehalten: Er hat zwei Stoppschilder überfahren, als der Polizist ihn kontrolliert, entdeckt er, dass sein Name im Zusammenhang mit dem Verschwinden zweier Frauen auf einer Verdächtigenliste steht. Fortan wird sich ein Muster wiederholen: Ted Bundy beteuert seine Unschuld. Doch ihm werden immer mehr Taten vorgeworfen. Zweimal entkommt er aus dem Gefängnis, ehe es zum berühmten Prozess in Florida kommt. Der Titel des Films ist – abermals ähnlich zu „Bright Young Women“ – ein Zitat aus dem Urteilsspruch.
Zu keinem Zeitpunkt ist im Film klar, welche und wessen Geschichte eigentlich erzählt werden soll: Liz Kendalls? Also die einer Frau, die mit einem Serienmörder zusammenlebte, mit ihm ein Kind großziehen wollte, und die einerseits früh ahnt, dass er möglicherweise etwas verbirgt, es andererseits aber nicht wahrhaben will. Dieser hochinteressante Aspekt – sie war es, die seinen Namen erstmals gegenüber der Polizei erwähnte – wird gegen Ende „enthüllt“ und ist doch ein so spannendes, dass man ihm viel ausführlicher hätte nachgehen können, vielleicht sogar sollen. Stattdessen wird Liz ab Bundys Verhaftung hauptsächlich in verschiedenen Stadien des Leidens gezeigt. An keiner Stelle können sich Drehbuchautor Michael Werwie oder Regisseur Joe Berlinger entscheiden, ob Liz nun eigentlich eine nützliche Idiotin, tatsächlich eine Ausnahme oder doch ein weiteres Opfer Bundys ist. Diese Uneindeutigkeit zeigt sich auch bei Carole Ann Boone (Kaya Scodelaria), die Bundy heiratete und ein Kind von ihm bekam. Oder den Frauen im Gerichtssaal, die immer wieder wie Groupies wirken und der Film will sie nicht verurteilen, weil er ihre Bewunderung zur Untermauerung von Bundys behaupteten Charisma braucht, macht sich aber doch auch etwas lustig über sie.
Will der Film also die Geschichte Ted Bundys erzählen? Weiterlesen