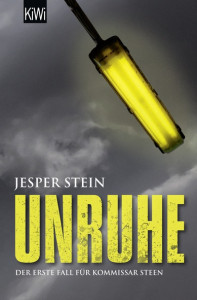Hinweis: Dieser Artikel behandelt die komplette dritte Staffel von „Sherlock“ und enthält daher viele Spoiler!
Wie weit darf man es mit dem Zuschauer treiben? Diese Frage habe ich mir während der dritten Staffel von „Sherlock“ einige Male gestellt. Ich mag „mindfucking“ Filme und Serien, ich liebe es, in die Irre und auf falsche Fährten gelockt zu werden. Jedoch gibt es auch innerhalb der Serienfiktion Grenzen und die Gefahr, dass alles nur noch zum Spiel wird.
Folge 1 – Der leere Sarg
Die erste Folge beginnt mit der erwarteten Wiederkehr von Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch), im Mittelpunkt steht daher das Wiedersehen mit seinen Mitstreitern und insbesondere John Watson (Martin Freeman). Insbesondere die erste halbe Stunde ist sehr unterhaltsam: Es werden mögliche Szenarien abgehandelt, wie Sherlock sein Ableben inszeniert haben könnte, immerhin gibt es nach seiner eigenen Sherlocks Aussage 16 Varianten – allein, wie er es letztlich getan hat, wird nicht aufgelöst, vielmehr reichen die verschiedenen Möglichkeiten. Hier reflektiert die Serie sehr schön die vielen Spekulationen, die es nach dem Ende der zweiten Staffel gab, außerdem vereint diese erste Folge alle Qualitäten der ersten beiden Staffeln: Sie ist temporeich, steckt voller Anspielungen und unterhält sehr gut.
Die offensichtlichste Quelle für diese Folge, auf die auch der Titel anspielt, ist die Kurzgeschichte „Das leere Haus“, in der Sir Arthur Conan Doyle die Umstände von Sherlocks vorgetäuschtem Tod enthüllt und er nach London zurückkehrt, um Moriartys Kompagnon zu überführen. Johns Verlobung mit Mary Morstan findet bei Doyle indes in dem Roman „The Sign of the Four“ statt (in dieser Folge Mary zu sehen, wie sie in Johns Blog eine Geschichte liest, die ein Auszug aus diesem Buch ist), der in der nächsten Episode aufgegriffen wird. Daneben gibt es weitere kleinere Anspielungen auf Geschichten von Arthur Conan Doyle, insgesamt deutet sich aber an, dass die ‚bromance‘ zwischen Sherlock und John größeren Raum einnehmen wird.
Folge 2: Im Zeichen der Drei
Bereits der Titel verweist auf die offensichtliche Inspiration der Folge – „The Sign of the Four“ – und im Mittelpunkt steht Marys (Amanda Abbington) und Johns Hochzeit. Nun hätte ich kaum gedacht, dass ich jemals über eine „Sherlock“-Folge sagen werden, dass sie langweilig ist. Aber in dieser Episode wird sehr viel Zeit darauf verwendet, abermals Sherlocks und Johns Verhältnis zu beschreiben, bekannte Charakterzüge noch einmal deutlich zu machen, es gibt viele Anekdoten und kleine Witzeleien, die mit einem letztlich wenig interessanten Fall und vielen kleineren Fällen kombiniert werden. Vielleicht hätte mir diese Folge besser gefallen, wenn ich eine große Sherlock/Cumberbatch-Aficionada wäre. Fraglos spielt er diese Rolle großartig, harmoniert mit Martin Freeman nahezu perfekt und ist seine Rede auf der Hochzeit wirklich amüsant – aber die Figuren und Schauspieler allein tragen nicht eine ganze Folge. Dass es zu einem Vorfall auf der Hochzeit kommt, ist natürlich klar, einzig überraschend sind hier abermals Marys Qualitäten, die energisch zur Tat schreitet. Jedoch stimmt insgesamt das Erzähltempo nicht, außerdem wird auf die Ereignisse der vorgehenden Episode nicht Bezug genommen. Weder Johns Kidnapping wird erwähnt, noch gibt es weitere Entwicklungen mit Charles Magnusson, der anscheinend in dieser Staffel der große Bösewicht sein soll. Stattdessen werden weiterhin Sherlocks Seelenleben und Persönlichkeit erkundet, auch wird sein Bruder Mycroft – der ohnehin immer breiteren Raum einnimmt – immer mehr zu einem Verbündeten und zugleich einem Widersacher. In Verbindung mit einer stärkeren Handlung wäre es eine sehr interessante Entwicklung gewesen, aber so bleibt doch der fade Nachgeschmack, dass in einer Serie, die pro Staffel aus drei Folgen besteht, viel Zeit verschwendet wurde.
Folge 3: Sein letzter Schwur
Der Plot der Folge basierten im Wesentlichen auf Arthur Conan Doyles Kurzgeschichte „The Adventure of Charles August Milverton“, auf die bereits der Name Charles August Magnussen (Lars Mikkelsen) anspielt. Er ist hier ein Zeitungsmogul, der über ein umfangreiches Archiv voller belastender Materialien verfügt (die Verweise auf Rupert Murdoch sind mehr als deutlich). Sherlock und John Watson wollen einige der Briefe zurückholen, zumal Magnussen auch Mary erpresst. Und was bereits für John Watson galt, trifft auch auf seine Frau zu: Wer sich mit dem Ehepaar Watson anlegt, bekommt es mit Sherlock Holmes zu tu!
Die Anspielungen auf Sherlocks Heroinsucht und andere Fälle sind gelungen, auch ist grundsätzlich sehr zu begrüßen, dass er mit Charles August Magnussen wieder einen ebenbürtigen Gegenspieler hat. Allerdings wird diese Figur nahezu verheizt: In der ersten Folge der Staffel erwähnt, in der zweiten vergessen, wird er nun innerhalb einer Folge zu dem Mann, der Sherlock am meisten hasst, stilisiert, dann wird aber seine Überlegenheit dramaturgisch nicht ausgenutzt, sondern er verschwindet dank eines soziopathischen Anfalls von Sherlock von der Bildfläche. Dafür bleiben viele Fragen offen: Magnussons „mind-palace“ ist eine raffinierte Idee, wie konnte er aber so viele Menschen erpressen, ohne physische Beweise zu haben? Reicht tatsächlich eine Behauptung schon aus? Falls ja: Warum sollte ich mich auf die Glaubwürdigkeit der Behauptung verlassen? Ohnehin verlangt Drehbuchautor Steven Moffat, dass man vieles hinnimmt – allein weil es eine weitere Wendung verspricht. Es gibt so viele abgerissene und wieder aufgegriffene Erzählstränge, dass es fast schon wahllos wirkt. Und dass Mary sich plötzlich als Auftragsmörderin entpuppt, mag sicher zum Teil mit Johns Faible für gebrochene Menschen zusammenhängen, ist aber selbst für John schwer zu glauben. Und wie konnte sie anfangs auch Sherlock täuschen? Sogar bei der überraschenden Wiederkehr von Moriarty zumindest der schale Nachgeschmack, dass er ein wenig zu früh zurückkehrt. Gerade wenn ich mich auf die Tendenz einlasse, dass es mehr im Sherlocks Seelenleben geht, wäre es doch spannender, wenn Moriarty noch eine Staffel einfach nur in Sherlocks Kopf weitergelebt hätte. Zumal er mit Magnussen einen vielversprechenden Nachfolger gehabt hätte. Abgesehen davon halte ich es durchaus für möglich, dass das Video bereits vor seinem Tod entstanden ist und nun einem Masterplan folgend von einem seiner Schergen benutzt wird. Schließlich ist ein Kopfschuss nicht so leicht vorzutäuschen – es sei denn, wir erfahren nun, dass Sherlock damit die ganze Zeit gerechnet hat, schließlich war er der einzige, der den Selbstmord mit angesehen hat.
Fazit
Insgesamt steht in dieser Staffel der Charakter von Sherlock viel mehr im Mittelpunkt als die Fälle, die Jagd nach den Bösewichtern. Indem die Serie zunehmend die soziopathische Seite des Detektivs erkundet, bleibt weniger Zeit für die Einführung von Gegenspielern und Ermittlungen, so dass die Aufklärung allein Sherlocks ‚Superkräften‘ anzulasten ist. Außerdem wird seine Involvierung in die Geheimdiensttätigkeiten seines Bruders beständig betont, daher wird er immer mehr zum ‚Agenten seiner Majestät’, wird zu einem Helden, der gelegentlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden muss. Vom Detektiv aus der Baker Street bleibt somit immer weniger übrig und ich frage mich, ob er durch die ständige Betonung seiner Genialität sowie Exzentrik nicht auch seine Individualität einbüßt. Es mag zunächst widersprüchlich klingen: Aber ist dieser Sherlock, der insbesondere durch die Fähigkeiten seines Gehirns beeindruckte, nicht längst eine so entrückte Figur geworden, dass diese Talente nicht mehr besonders gefragt sind? Ist er mehr Geheimagent denn Privatdetektiv? Mir hat jedenfalls das Geheimnisvolle gefehlt, die Neugier und die Spannung. Sicher war „Sherlock“ niemals eine „detective show“, sondern eine Serie über einen Detektiv (so hat es Mark Gatiss selbst einmal formuliert), aber auch eine Serie über einen Detektiv braucht mehr als immer noch eine Wendung, noch eine Drehung und noch ein überraschendes Moment. Und hier läuft die Serie meiner Meinung nach trotz der guten Schauspieler, der vielen tollen und originellen Szenen Gefahr, den Bogen schlichtweg zu überspannen.
„Im Zeichen der Drei“ und „Sein letzter Schwur“ werden am 8. und 9. Juni um 21:45 Uhr in der ARD ausgestrahlt.