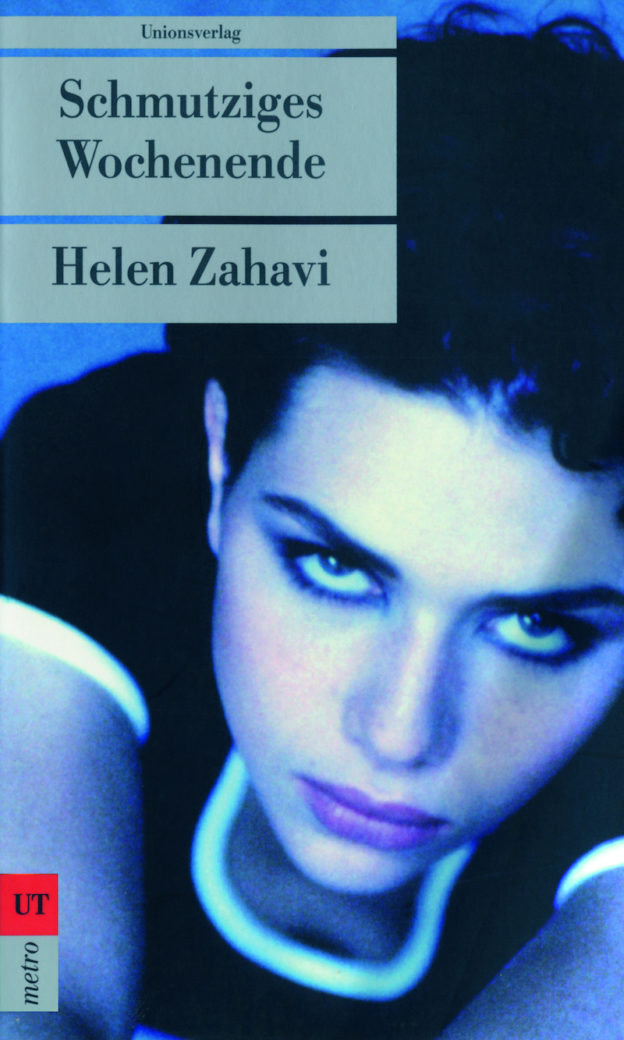Momentan verschwinden in vielen Kriminalromanen wieder sehr häufig Menschen. Meistens sind es Frauen, sehr junge Frauen oder Teenagerinnen. Im September hatte ich im CrimeMag bereits über zwei Titel geschrieben – „So ist das nie passiert“ von Sarah Easter Collins und „The Return von Ellie Black“ von Emiko Jean. In beiden verschwindet die Schwester einer der Erzählerinnen, beide Male ist es die Wildere, die Mutigere der Schwestern, die verschwindet – und die Brave, die Angepasste ist diejenige, die unter dem Verschwinden leidet und es dann später aufklärt.
Der Topos des Verschwindens von Mädchen ist nicht neu, sein Reiz liegt an der Kombination aus (angenommener) Unschuld und Verbrechen – und natürlich lädt so ein Verschwinden regelrecht dazu ein, hinter die Fassaden vermeintlich „normaler“ Familien oder auch Gesellschaften zu blicken. Aber es schwingt oftmals auch noch etwas anderes mit, gerade weil es oft die Rebellinnen sind, die verschwinden – eine Warnung, die mir Unbehagen bereitet: Solche Dinge passieren denjenigen, die sich auflehnen, die feiern wollen, die etwas mehr vom Leben haben wollen als das, was ihnen die Kleinstadt geben kann. Pass also auf, dass Du immer schön brav und zufrieden bleibst – sonst passiert Dir das auch.
Glücklicherweise passen nicht alle Bücher in dieses Muster – wie man mit dem Verschwinden auch umgehen kann, zeigt „Hard Girls“ von Robert J. Lennon. Einst ist die Mutter der Schwestern Jane und Lila Pool verschwunden. Eine erwachsene Frau, damit ist von vorneherein mehr Spielraum für eigene Entscheidungen gegeben. Und sofort entsteht eine Frage: Warum verlässt eine Mutter ihre Töchter? Ein ungeheurer Entschluss, selbst für eine Frau wie die Mutter von Jane und Lia, die schon immer anders war als andere Mütter. Unzuverlässiger, rastloser, schöner. Sie wollte genau das nicht, was angeblich alle Frauen wollen: Gebraucht werden. Und das hat sie ihren Töchtern von Geburt an überaus deutlich zu verstehen gegeben. Lange Zeit dachte Jane daher auch, ihre Mutter sei einfach mit irgendeinem Liebhaber abgehauen. Dann platzt in ihr unglückliches Leben in einer Kleinstadt eine verschlüsselte Nachricht ihrer Zwillingsschwester. Lila ahnt, wo ihre Mutter ist. Jane weiß, dass ihre Schwester meistens Ärger bedeutet. Aber dennoch ist sie neugierig. Und sehnt sich insgeheim auch nach etwas Abenteuer und Abwechselung in ihrem Leben als Angestellte in einer College-Verwaltung und Mutter einer Teenager-Tochter.
Mehr will ich über die Handlung gar nicht verraten: Sie ist abwechselungsreich, es macht Spaß, von diesen Entwicklungen überrascht zu werden – und es gibt es Ende, das abenteuerlich und für lange Zeit unvorhersehbar ist. Nur so viel: Das Verschwinden der Mutter ist tatsächlich ein freiwilliger, völlig selbstsüchtiger und wahnwitziger Entschluss.
Damit verweist Lennon auch darauf, dass tatsächlich viele Menschen freiwillig verschwinden. Gerade in den USA, wo es aufgrund des anderen Meldegesetzes einfacher ist, ein neues – oder auch zweites – Leben anzufangen. Interessant ist zudem, welche Motive er in seinem Krimi noch aufgreift, ohne dass eines klar im Vordergrund steht: Da ist zunächst einmal ein deutliches Spionageelement. Von Anfang an deutet sich an, dass der Vater von Jane und Lila möglicherweise getarnt als College-Professor für die CIA gearbeitet hat. Er war während der Hochzeit des Kalten Krieges am College, ist dort aufgefallen und wurde von einem geheimnisvollen Mann angesprochen. Wohin dieser Handlungsstrang führt, ist in seiner ätzenden Banalität recht komisch – und sagt zugleich sehr viel über jene Jahre und ihre Folgen aus.
Und dann die Beziehung der Schwestern. Anfangs scheint es, als hätten sie sich als Erwachsene aus den Augen verloren. Aber schon bald stellt sich heraus, dass es alles nicht so einfach ist. In Rückblicken wird von der Kindheit und Jugend der Schwestern erzählt, dem Leben mit einer unglücklichen Mutter und einem zerstreut-abwesenden Vater, von geheimen Spielen und Codes, einer Zeit als Ausreißerinnen in besetzen Häusern und freiwilligen Gemeinschaften. Das alles ist mit lakonischen Sätzen durchzogen, es gibt viele Wendungen, einige Action.
Außerdem dieses unglückliche Leben von Jane. Sie war im Gefängnis, hat dort ihre Tochter bekommen, danach ihren Jugendfreund geheiratet und ist nun sehr unglücklich. Eine ganze Weile dauerte es, bis ich verstehen konnte, warum sie bei ihrem Mann und in ihrer Ehe bleibt. Aber Lennon liefert tatsächlich einen Grund, einen sehr nachvollziehbaren Grund. Am Ende deutet sich dann an, dass es weitergehen wird mit dem Poole-Schwestern. Es scheint in eine eher vertraute Richtung zu gehen – aber wer weiß: Schon in diesem Buch dachte ich oft genug, ich wüsste, worauf es hinausläuft und wurde doch überrascht.
J. Robert Lennon: Hard Girls. Aus dem Englischen von Stefan Lux. Suhrkamp 2025. 416 Seiten. 18 Euro.