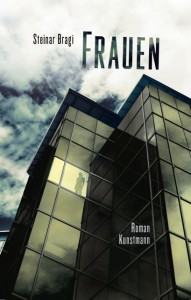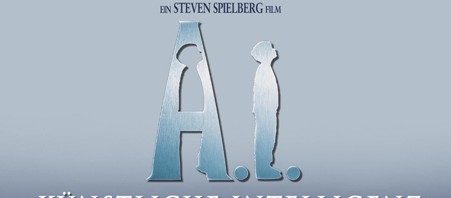(c) Warner Home Video
Vor Jahren habe ich im Zuge eines Stanley-Kubrick-Seminars an der Uni bereits „A.I. – Künstliche Intelligenz“ auf DVD gesehen – und fand den Film mäßig. Nun habe ich ihn für einen weiteren Beitrag für das Zeilenkino erneut gesehen – und finde ihn immer noch mäßig. Die Gründe sind recht schnell aufgezählt: 1. Nach einem guten Anfang und ansprechenden Mittelteil ist der Schluss viel zu lang und rührselig geraten. 2. Die Musik ist oftmals zu kitschig. Und 3. Verschenktes Potential!
Die Gründe für die starken Unterschiede zwischen den drei Teilen des Films habe ich stets in der Produktionsgeschichte gesucht, die bis in die 1970er Jahre zurückreicht. Damals hat Stanley Kubrick Brian Aldiss, den Autor der Kurzgeschichte „Super Toys Last All Summer Long“, angeheuert, eine Filmversion seiner Geschichte zu schreiben. Aber die Produktion des Films ließ auf sich warten. Anfangs war Kubrick mit Aldiss‘ Arbeit nicht einverstanden und feuerte ihn 1989, dann wollte er warten, bis die Spezialeffekte, die er sich vorstellte, auch umzusetzen sind. Mal wollte Kubrick selbst Regie führen, dann schlug er Steven Spielberg vor – der von ihm bereits 1985 ins Produktionsteam geholt wurde. Nach Kubricks Tod 1999 nahm Steven Spielberg auf Bitten von Kubricks Witwe die Umsetzung des Films in die Hand. Er schrieb das Drehbuch, übernahm die Regie und brachte den Film in die Kinos.

David mit Teddy (c) WHV
Nun war für mich beim erstmaligen und auch heutigen Sehen eigentlich klar, dass das kitschige Ende, die Flüssigkristallwesen und das märchenhafte Happy End nur von Steven Spielberg stammen könnte. Ich war überzeugt, dass es bei Kubrick weitaus düsterer, verklärter und auch mehrdeutiger ausgefallen wäre. Doch dann stolperte ich im Internet über ein Interview, in dem Steven Spielberg sagt, dass „all the parts of A.I. that people accuse me of sweetening and softening and sentimentalizing were all Stanley’s. The teddy bear was Stanley’s. The whole last 20 minutes of the movie was completely Stanley’s. The whole first 35, 40 minutes of the film – all the stuff in the house – was word for word, from Stanley’s screenplay. This was Stanley’s vision“. Sicherlich stellt sich weiterhin die Frage, wie man diesen sentimentalen Schluss filmt – dennoch hat mich dieses Statement überrascht. Meine Kritik bleibt bestehen, aber nun schiebe ich es nicht mehr Spielberg in die Schuhe.
Das verschenkte Potential des Films ärgert mich ohnehin weitaus mehr. Stanley Kubrick hat von diesem Film immer als „Pinocchio“ gesprochen und tatsächlich erinnert „A.I.“ an eine futuristische Version des Kinderbuches von Carlo Collodi. „A.I.“ erzählt die Geschichte des kleinen Roboter-Kindes David, das gerne ein richtiger Junge werden will, damit er die Liebe seiner Mutter gewinnt. Inspiriert durch das Märchen macht er sich – nachdem er von seinen Test-Eltern verstoßen wurde – auf die Suche nach der blauen Fee, die er am Ende der Welt, dort wo die Löwen weinen, finden soll. Anders als Pinocchio muss das Mecha-Kind David nicht erst lernen, ein fleißiger und ehrlicher Junge zu sein. Stattdessen ist er ein vorbildlicher Sohn, der seiner Mutter in unendlicher Liebe zugetan und stets um ihr Wohlbefinden besorgt ist. Vermutlich ist es diese Überlegenheit und die Fixierung auf Monica, die David auch für seinen Test-Vater Henry und den echten Sohn Martin so bedrohlich machen. Denn die Familie und die Gesellschaft sind nicht darauf eingestellt, dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe zu erwidern. Monica ist ihrem Mecha-Kind fraglos zugetan – aber auch für sie ist der eigene Sohn wichtiger.

Die bunte Welt von Rouge City (c) WHV
Im Anfangsteil sind die wichtigen Fragen filmisch gut ausgearbeitet. Die heile Welt der Familie Swinton ist derart artifiziell, dass sie bedrohlich wird. Auch die kalte Hybris der Forscher, Roboter mit Gefühlen zu entwickeln, wird gut entwickelt. Aber auf die wichtigste Frage verweigert der Film eine Antwort (obwohl sie zu Beginn von einer Forscherin gestellt wird!): Wenn wir Roboter erschaffen, die lieben können, müssen wir diese Gefühle dann nicht erwidern können? Statt dieser Frage nachzugehen, wird im Mittelteil mit einer Mischung aus märchenhaften Elementen und filmischen Referenzen an „2001“, „Clockwork Orange“, aber auch an „Blade Runner“ eine Gesellschaft dargestellt, in der die mechanischen Helfer, die für alle möglichen Belange geschaffen wurden, aufgrund ihrer Perfektion zunehmend zu einer Bedrohung werden. Anscheinend könnten gefühlsbegabte Roboter am Ende die besseren Menschen sein. Stattdessen wird aber am Ende des Films ein Loblied der menschlichen Fähigkeit zur Fantasie, Imagination und des Wünschens gefeiert. Und mit keinem Wort wird der Frage nachgegangen, warum sich der Mensch weigert, auch die moralischen Folgen seines Handelns abzusehen.