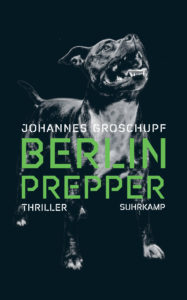Zu Attica Lockes neuen Roman habe ich nicht nur das Nachwort geschrieben, sondern auch für den Polar Verlag ein Interview mit ihr geführt.
Warum schreiben Sie Kriminalromane?
Mich fasziniert die Psychologie von Menschen, die Verbrechen begehen. Außerdem erlauben Krimis, gesellschaftliche Themen zu erforschen, ohne polemisch oder didaktisch zu wirken.
„Bluebird, Bluebird“ und „Heaven, My Home“ sind die ersten beiden Teile eine der Highway-59-Reihe – wie würden Sie sie beschreiben?
Die Reihe folgt Texas Ranger Darren Matthews, der Ermittlungen zu Verbrechen in kleinen Städten am Highway 59 im Osten von Texas durchführt. Meine Familie – sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits – kommt aus Kleinstädten am Highway 59. Ich bin mit Fahrten auf diesem Highway zu meiner Verwandtschaft aufgewachsen, das ist ein wichtiger Teil meiner Lebensgeschichte und des Lebens meiner Vorfahren. Ich wollte über die Schwarzen Texaner in Ost-Texas schreibe.
Warum ist Ihre Hauptfigur ein Texas Ranger?
Als ich beschloss, eine Reihe zu schreiben, wusste ich, dass ich eine Hauptfigur brauche, die in jedem Buch vorkommt. Da es aber um den Highway 59 gehen soll, der von Laredo im Süden bis Texarkana im Norden führt, durfte die Hauptfigur nicht zu sehr an einen Ort gebunden sein. Die Zuständigkeit der Texas Ranger ist viel weiter gefasst als die anderer Stafverfolgungsbehörden im Staat. So kam ich auf die Idee, die Hauptfigur zu einem Texas Ranger zu machen.
In Deutschland denken die meisten bei „Texas Ranger“ wohl an die Serie mit Chuck Norris. Wie werden sie in Texas und in USA gesehen?
Wie Sie haben die meisten Menschen in den USA vermutlich lediglich eine Ahnung, was ein Texas Ranger eigentlich ist – und diese beruht vermutlich ebenfalls auf besagter Fernsehserie. In Texas hingegen gelten sie als Eliteeinheit. Es gibt nur rund 150 Texas Ranger in dem gesamten Staat. Und sie dürfen gegen andere Strafverfolgungsbehörden ermitteln. Sie sind wie ein Mini-FBI.
Wie die Vorstellung der Texas Ranger ist auch die Vorstellung von Texas sehr von Büchern und Filmen geprägt, Ihre Romane erweitern dieses Bild.
Ich wollte, dass die Leute bei Texas nicht nur an weiße Rancher denken, sondern auch an einen Ort, an dem Schwarze Cowboys und Farmer leben. Der Osten von Texas unterscheidet sich zudem sehr vom Südwesten des Bundestaates, er ist dem amerikanischen Süden viel ähnlicher. Denken Sie also an Kiefern und Bäche statt an Kakteen und Wüste.
Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Texas beschreiben?
Es ist ein großer Teil meiner Identität. Ich liebe, woher ich komme. Aber meistens mag ich die Politik in Texas nicht. Es ist eine komplizierte Beziehung: Ich liebe es, ich liebe es, “nach Hause” zu kommen, aber ich betrachte auch Kalifornien als mein Zuhause.
Die Frage, was Heimat eigentlich ist, wird in beiden Romanen erforscht. Was ist Heimat – auch für Sie?
„Heaven, My Home“ behandelt Heimat noch expliziter als der erste Roman und erzählt davon, wie schwierig es für Schwarze Amerikaner und Natives sein kann, sie zu definieren. Was bedeutet Heimat für die Caddo, von denen die meisten heutzutage in Oklahoma leben, was nicht ihre Heimat ist? Und was bedeutet Heimat für Schwarze, die in der Zeit der Sklaverei aus Afrika auf eine Plantage gebracht wurden?
Heimat ist – auch für mich – ein unsicheres Konzept. Ich lebe in Los Angeles, aber ein Teil meiner Seele lebt in Osttexas, wo meine Vorfahren herkommen.
Zu dieser Heimat und ihren Romanen gehört zweifellos auch der Blues, schon der Titel „Heaven, My Home“ ist ein Verweis auf einen Blues-Song. Was bedeutet Ihnen diese Musik?
Bluesmusik gibt mir das Gefühl, eng mit meiner Herkunft verbunden zu sein. Insbesondere Lightnin Hopkins ist meine Muse. Seine Musik ist so, wie ich auf dem Papier sein will: Schlau, lustig, weise und ehrlich.
Ich höre immer Musik, wenn ich schreibe. Sie hilft mir, in die richtige Stimmung zu kommen, sie hilft mir, mein Herz und meinen Verstand anzuregen. Und ich denke gerne, dass meine Prosa einen poetischen Stil hat, dass Musik meinen Stil prägt. Außerdem erwähne ich auch gerne Songs in den Büchern, sie verstärken das Gefühl für den Ort, denke ich.
Ihre Romane sind sehr gegenwärtig, ich konnte die Agonie, die Verwirrung und auch Angst nach der Wahl Trumps fast spüren. Warum spielt der Roman zwischen der Wahl und Inauguration Trumps?
Aufgrund der Ereignisse am Ende von „Bluebird, Bluebird“ musste ich die Geschichte innerhalb von Wochen nach diesen Geschehnissen aufgreifen. Es wäre unglaubwürdig gewesen, dass sechs Monate oder ein Jahr vergangen sind, ohne dass zwischen Darren und seiner Mutter etwas wegen der Waffe geschehen wäre. Also beginnt „Heaven, My Home” ungefähr sechs Wochen nach „Bluebird, Bluebird”, was bedeutet, dass Trump zwar gewählt war, aber noch nicht im Amt. Letztlich hat es mir auch die Möglichkeit gegeben, eine Art „tickende Uhr” zu schaffen – ein Gefühl der Dringlichkeit unter den Texas Rangers und der Federal Task Force, Anklage gegen eine White-Supremacist-Gruppe zu erheben, bevor ein White Supremacist sein Amt antritt.
Wie haben Sie auf die Wahl Trumps reagiert?
Ich war am Boden zerstört. Sie fühlte sich an wie eine Zurechtweisung für die Fortschritte, die gegen Rassendiskriminierung unternommen wurden und von denen ich hoffte, sie würden weitergehen. Seit seiner Wahl bin ich voller Zorn. Ich bin die ganze Zeit über deprimiert und wütend.
Vergebung ist ein wichtiges Motiv in „Heaven, My Home“ – der Satz, „Schwarze sind die versöhnlichsten Menschen auf der Welt“ fällt einige Male. Wie stehen Sie dazu?
Ich denke, dass diese Aussage wahr ist. Aber ich denke auch, dass die Zeile im Buch, dass wir nicht wissen, ob es uns zu Heiligen oder Handlangern macht, ebenfalls wahr ist. Black Forgiveness richtet sich oftmals gegen uns: Es ist ein Schauspiel, dass einige Weiße tröstet und sie davon abhält, ihr rassistisches Verhalten zu ändern.
Geschichte ist für Ihre Romane ebenfalls wichtig. Wie haben Sie sie recherchiert – und was bedeutet Geschichte für Sie?
Ich bin nach Jefferson, Texas gefahren, habe Zeit am Caddo Lake verbracht. Außerdem habe ich viel zu der Geschichte der Gegend gelesen, viele Bücher über die Caddos und die Zeit in Jefferson vor dem Bürgerkrieg.
An Geschichte denke ich mit Faulkner: Es ist etwas, was immer bei uns ist und nichts, was man von der Gegenwart trennen kann. Wie gehen immer Seite an Seite mit den Geistern unserer Geschichte.
Ich habe gelesen, dass das Buch durch eine Hochzeit auf einer Plantage inspiriert wurde …
Im Jahr 2004 war ich auf einer Hochzeit auf der Oak Alley Plantage in Vacherie, Louisiana. Ich war noch nie zuvor auf einer Plantage und die Gefühle haben mich überwältigt … aber auch verwirrt. Warum haben sich ein weißer Mann und eine Schwarze Frau dazu entschieden, auf dem blutgetränkten Land einer Plantage zu heiraten? Ich wartete den ganzen Abend darauf, dass jemand eine Rede hält und etwas Poetisches dazu sagt, wo wir sind und warum … dass wir uns alle dort versammelt hatten, um dieses geschundene Land mit Liebe zu erneuern und als Anerkennung dafür, wie weit wir in diesem Land nun gekommen ist.
Dann war ich zutiefst enttäuscht als sich herausstellte, dass das Brautpaar den Ort lediglich aufgrund seiner Schönheit ausgesucht hatten, dass sie sich nicht für die Geschichte interessierten. Damit begann meine Faszination für historischen Tourismus und die Art und Weise, wie diese Stätten umgestaltet und neu genutzt werden. Es erlaubt den Menschen zu vergessen, was auf Plantagen in den USA wirklich passiert ist. Ich war so verstört von alle dem – also habe ich ein Buch geschrieben.