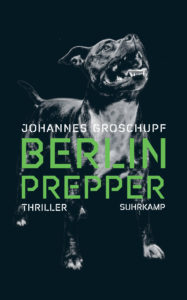Eigentlich wollten Johannes Groschupf und ich die Strecke abgehen, die die Hauptfigur seines Kriminalromans „Berlin Prepper“ zu Trainingszwecken zurücklegt. Aber das Wetter machte uns einen Strich durch die Rechnung. Also gingen wir stattdessen in ein Café, um uns über sein Buch und Berlin zu unterhalten.
Warum haben Sie einen Krimi geschrieben?
Johannes Groschupf: Ich hatte in den letzten sechs, sieben Jahren Arbeit bei verschiedenen Berliner Zeitungen oder auch überregionalen Zeitungen, dort habe ich einlaufende Kommentare der Leser bearbeitet. Und da kam mir ein Murren und so ein Groll der Bevölkerung entgegen, von dem ich immer gedacht habe, das müsste man mal erzählen. Das ist sozusagen ein Hintergrundrauschen, etwas, was die ganze Zeit da ist, aber was noch nicht richtig wahrgenommen wird. Und wenn das in den Medien besprochen wird, dann sagt man immer: rechte Ecke oder so. Das hat mich fasziniert. Es kam mir wirklich wie so eine düstere Wand vor, auf die ich zulief oder mit der ich dann ständig zu tun hatte. Und was mich beim Krimi interessiert hat, als Leser und Filmgucker, ist diese Noir-Seite, dieses Dunkle und ein bisschen Grimmige, was Krimis schon haben.
Also Sie haben den Job, den Ihre Hauptfigur Noack in Ihrem Roman hat, wirklich gemacht?
JG: Noack bin nicht ich, aber ich habe diesen Job gemacht, den er hat, auch in diesem Newsroom, der da beschrieben ist, ohne dass die Zeitung jetzt genannt wurde.
Wie lange haben Sie das gemacht?
JG: Insgesamt so sechs Jahre.
Haben Sie da das Gefühl, dass sich in den vergangenen Jahren im Umgang miteinander etwas verändert hat?
JG: Es hat sich in der Weise verändert, dass es immer mehr solcher Stimmen gibt. Und auch der Tonfall wird ruppiger und harscher, er wird auch ein bisschen herrischer, so dass sich die Schreiber dort in einer gewissen Weise für eine Art Machtübernahme oder so bereitmachen. Früher fühlten sie sich noch wie so eine unentdeckte Minderheit, so wir haben die Wahrheit, wir wissen, wie es eigentlich ist. Und gerade vor Wahlen oder so, gibt es dann schon so euphorische Stimmen: „Also es dauert nicht mehr lange, dann sind wir auch mit an der Regierung beteiligt.“ Man sieht es ja an Österreich.
Und wie gehen Sie damit um?
JG: Was macht das mit mir? Ja (lacht). Also wenn ich nach Hause gefahren bin nach so einer Acht-Stunden-Schicht – jetzt sind es Sechs-Stunden-Schichten – war das wirklich sehr anstrengend, dieses dauernde Prasseln von Kommentaren, die einem erklären, wie schlimm es um Deutschland steht, dass alles den Bach runtergeht, dass wir überrannt werden, dass wir geflutet werden, dass man sich auch nicht wehren kann, sondern dass man als Deutscher auch nur noch Mensch zweiter Klasse ist, dass man nur als Steuerkuh gemolken wird. Es ist auch digitale Drecksarbeit, muss man sagen. Und ich habe dann irgendwie versucht, mich zu wehren, indem ich versucht habe zu sammeln: Was für Metaphern benutzen diese Leute? Was sind das für wiederkehrende Bilder oder auch Hassecken, die sie haben? Aber eigentlich hassen die alles; die hassen Schwule und Moslems und Marokkaner und Frauen und wie auch immer.
Das hat mich ziemlich erschreckt, weil ich den Eindruck hatte, hier beginnt etwas, von dem erst mal noch viele Leute gar nichts wissen. Das war auch vor sechs Jahren wirklich noch eher so eine unentdeckte Stimmung in der Bevölkerung, jedenfalls für mich war das wirklich überraschend. Und dann gab es die Bundestagswahlen mit zwölf Prozent AfD, da wusste man schon, dass das wirklich ein Anteil in der Bevölkerung ist. Wenn ich dann hier dann in Kreuzberg oder mit meinen Leuten unterwegs war, habe ich aber gemerkt, dass man sich auch einfach am Leben freuen kann, oder dass man irgendwie unbeschwert sein kann. Das kam mir dann wirklich wie so eine Art Erholung vor. Es war sozusagen vorher immer mein eigentliches Lebensgefühl. Ja, auch wenn ich die Steuererklärung mache und den Müll rausbringe, habe ich trotzdem eigentlich Freude am Leben. Diese Leute nicht. Und begleitet man die sechs oder acht Stunden lang in ihrer Welt, dann vergällt einem das auch das Dasein.
Noack ist ja Prepper. Sind Sie das aus?
JG: Nein, ich bin überhaupt kein Prepper. Ich lebe von der Hand in den Mund, also zum großen Entsetzen meines Vaters. Prepper sind schon faszinierende Figuren. Man findet sie im Netz ganz, ganz viel. Es gibt auch Gruppen, denen ich dann beigetreten bin und wo ich mich beteiligt habe. Prepper antizipieren den Eintritt der Katastrophe, auf welche Weise auch immer, ob das jetzt irgendwie eine Seuche ist oder der Sturz des Euro oder der Stromausfall, der irgendwie nach zwei oder drei Wochen zu einem totalen gesellschaftlichen Chaos führt oder was auch immer, Militärputsch. Das kann alles sein und darauf wollen Prepper vorbereitet sein. Im Unterschied zu den Schlafschafen, wie Prepper sagen, die halt einfach so in den Tag hineinleben und ahnungslos sind, was uns alles bevorsteht. Klimakatastrophe, Eurokatastrophe, also wir sind umgeben von Katastrophen eigentlich. Und das fand ich interessant: Eine Figur zu untersuchen, die sich ständig gegen alle möglichen Bedrohungsszenarien versucht irgendwie zu wappnen, um zu überleben.
Man merkt ja, wie tief Noack dann verunsichert, dass das, was ihm widerfährt, nicht von ihm vorhergesehen wurde.
JG: Ihm wird der Boden unter den Füßen weggezogen, ja. Nicht nur, dass er niedergeschlagen wird, sondern dass er auch mehr und mehr n Milieus gerät, die mit unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht so wirklich mehr etwas zu tun haben. Das sind dann auch Wahrnehmungsfolien, also zum Beispiel die Reichsbürger, die eine bisschen randständige Rolle, aber doch eine Rolle spielen. Für die ist ja diese Wirklichkeit, in der wir leben, einfach eine Täuschung. Wir leben eigentlich in einem ganz anderen System. Wir werden belogen darüber, was es eigentlich ist. Und mit solchen Wahrnehmungsirritationen wollte ich Noack dann konfrontieren.
Für mich war es auch so ein bisschen so ein Spiel mit dem Klischee oder dieser Vorstellung von Preppern. Ich hatte aus amerikanischen Filmen eine gewisse Vorstellung, was das für ein Typ ist, und er erweist sich dann ja doch im Verlauf der Geschichte als jemand, der zumindest in seinen Ansichten erstaunlich differenziert ist.
JG: Ich finde das auch. Man macht sich über Prepper gerne lustig so. Also in Amerika, die Doomer oder die Prepper, die sich vor der Zombie-Apokalypse irgendwie versuchen zu wappnen, die kann man einfach nicht ernstnehmen, so wie es auch schwierig ist, die Reichsbürger ernst zu nehmen. Aber das ist für eine lebendige Figur ja unabdingbar, dass man ihr eine ganze Welt gibt und dass sie nicht da hinstellt, um sie dann auszulachen, sondern da ist auch eine Erfahrung dabei. Es ist natürlich eine selektive Wahrnehmung, aber auf eine gewisse Weise hat Noack auch recht.
Aber warum sollte man so etwas überleben? Ich war mal in einem Bunker bei Bonn, dem Atombunker und hinterher war ich überzeugt, falls jemals eine Atombombe abgeworfen wird, ich möchte das nicht überleben. Haben Sie eine Antwort darauf gefunden, warum Prepper sich darauf vorbereiten, solche Katastrophen zu überleben?
JG: Erstens, das mit dem Bunker, das kenne ich noch aus Kindheitszeiten. Wir hatten in der Schule, die damals neu gebaut wurde am Rande von Lüneburg, da wurde für den kommenden Atomkrieg schon mal ein Krankenhaus hingestellt. Für uns Kinder war das ganz super, weil wir da ganz toll spielen konnten, solange das gebaut wurde. Aber mir kam schon damals die Frage, beim Atomkrieg oder so, wir kannten ja diese Bilder des Atompilzes und dann auch diese Vorstellung der Neutronenwaffe, die alles sozusagen Leben kaputtmachte, nur dass dann noch die Städte stehen, was soll man dann in so einem Bunker oder in so einem Krankenhaus, oder? Und die obere Welt ist dann sowieso unbenutzbar auf Jahre so. Aber ich denke, dass es für Prepper gar nicht so wirklich darum geht, was in zehn Jahren oder so ist, sondern sie wollen halt jetzt einfach so eine Art Praktik oder so Praxis entwickeln, um mit diesem ja auch von ihnen selbst evozierten Katastrophenszenario ständig umgehen zu können. In diesen Prepper-Foren ist es dann doch meistens so, dass sie Einkaufstipps tauschen, ja, dass es bei Lidl irgendwie so einen Grünkohl in der Dose gibt, der kostet 99 Cent, hält sich ewig, schmeckt wie bei Muttern, und man kann sich irgendwelche Messer dann günstig da und da erwerben. Und so ist das wie so eine Einkaufstippbörse so – eben unter diesen gemeinschaftlich geteilten Dingen, dass die Zeiten wirklich schlimm sind und dass einem das keiner sonst glaubt. Also die fühlen sich da auch sehr verlacht oder in der Minderheit, aber sie haben eben, wie so bei manchen Sekten das ist, einfach diese Überzeugung, wir wissen es eigentlich besser. Deren Vorstellung ist schon auch so eine, gerade in Amerika, aber auch gerade hier in Berlin und in Brandenburg, dass man in die Wälder geht. Ja, dass man wieder in so einen urtümlichen Zustand zurückkehrt, wo der Mann ein wirklicher Mann ist, wo er jagt und Tiere erlegt und damit seine Familie versorgt.
In Ihrem Roman hängen die größten Bedrohungen ja mit dem Sicherheitsdienstleuten zusammen.
JG: Ich fand die interessant. Das ist auch eine Boom-Branche, was ich gar nicht so wirklich realisiert habe, aber in den letzten Jahren, das ist doch immer mehr, dass irgendwelche Sicherheitsleute bestimmte Gebäude schützen. Und ich habe das früher so als Tourist in Dritte-Welt-Ländern gesehen, dass da vor den Banken Männer mit Maschinenpistolen sind. Das ist auch jetzt in den USA. Hier in Berlin ist das noch nicht so, aber so eine große Zeitung wird eben auch vom Sicherheitsdienst geschützt. Und damit verbindet sich natürlich auch so eine gewisse Übernahme. Man kauft sich da ja im Grunde so eine kleine Armee, ja, zur eigenen Sicherheit und erlangt damit auch eine gewisse Art von Macht. Das hat mich dann schon interessiert. Also das ist ja auch in den Kriegen heutzutage, dass die zum Teil privatisiert werden so, sodass man im Krimi vielleicht auch das durchspielen kann, dass die öffentliche Sicherheit auch mehr und mehr von den Leuten, die sich das leisten können, privatisiert wird – wie eine große Zeitung. Und solche Sicherheitsdienste ziehen natürlich auch eine Art von Leuten heran, die als Figuren im Krimi gut zu gebrauchen sind, weil sie nämlich irgendwie nach Befehlen handeln und auch vor Gewalt eigentlich nicht zurückschrecken. Das war mein Plan.
Es sind ja oftmals schlecht ausgebildete, schlecht bezahlte Menschen.
JG: Die einem aber auch leidtun können, weil irgendwie das Leben ist dann doch gering und sie stehen auch die ganze Zeit nur herum. Also sie haben ja eigentlich auch, also müssen sich immer wieder motivieren, indem sie so eine Art Bedrohungsszenario aufbauen, ja? Diese Zeitung oder dieses Gebäude oder so könnte irgendwie jetzt von Leuten infiltriert oder betreten oder, weiß ich nicht, irgendwie einfach bedroht werden. Dadurch hatte ich dann sozusagen wieder eine weitere Facette dieses ganzen bedrohungsapokalyptischen Szenarios. Na, also apokalyptisch ist das ja gar nicht. Es ist ja doch eigentlich recht alltäglich so.
Ich finde alle Ereignisse in Ihrem Roman erschreckend alltäglich. Dieser Ablauf, er wird überfallen, er ist verunsichert, und dann kommen Leute, die sagen, das waren doch die und das waren doch die und dann der Sohn, der ein bisschen zu neugierig ist, das fand ich von der Eskalationsspirale erschreckend realistisch.
JG: Ich bin dann auch so ein bisschen losgegangen, es hatte mich dann auch interessiert, wo kann man zum Beispiel hin, wenn man in Berlin schießen will. Das hatte ich dann von einem Redakteur gehört, der so im Gespräch mal beim Kaffee sagte, dass er jetzt ein Schießtraining macht. Das wäre für mich vor zehn Jahren undenkbar gewesen, aber es gibt offenbar für manche Leute so ein Bedürfnis, jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendeinen Sport auszuüben, Squash zu spielen, sondern er macht eine Schießausbildung. Und dann habe ich mir so Berliner Schießstände rausgesucht und bin da auch da im Tempelhof zu einem hingegangen, der auch wirklich in einem Bunker liegt. Das war als Szenerie ganz, ganz klasse, dass man den Eingang gar nicht richtig fand, und da musste man klingeln, dann wurde einem die Tür geöffnet und dann ging man so eine Bunkertreppe runter. Und man hörte drinnen also im Bauch der Erde sozusagen diese Schüsse peitschen. Und die Leute waren auch wirklich nicht freundlich oder haben mich da gar nicht haben wollen, sondern die sagten: „Hier gibt es keine Schnupperkurse oder so, was wollen Sie hier?“ Aus solchen Ablehnungen mache ich dann gerne umso mehr, weil dann wird meine Fantasie angeregt. Und das gehört auch mit zum Berliner Alltag, den wir aber nicht so richtig wahrnehmen, weil man da so eine Bunkertreppe runtergehen muss. Auch diese Security-Leute nimmt man nicht so wirklich wahr, weil sie einfach nur herumstehen, ja? Und dann stehen immer mehr herum.
Es ja sehr auffällig, dass Sie sich an den Orten, an denen der Roman spielt, auskennen. War von vornerein klar, dass Sie das, wenn Sie das in Berlin ansetzen?
JG: Ich glaube, ich hatte mal einen anderen Ort, wo er lebt, denn eigentlich ist dieser Noack nicht das, was man sich unter einem Kreuzberger, gerade nun in 36 vorstellt. Der ist überhaupt nicht linksalternativ, so ganz und gar nicht. Wenn ich schreibe, spielen die meisten meiner Romane in Berlin und ich finde es wichtig, dass die Orte, die ich beschreibe, die wirklich da sind oder sein könnten. Es gibt auch in der Realität so kleine Details, die man nur dort findet. Die muss ich mir nicht ausdenken. Sie sind viel besser, wenn ich die finde, wie dieser Schießstand in Tempelhof. Noack wohnt einfach in der Gegend, in der ich mich gut auskenne und in der auch diese Erfahrung gemacht habe. Er geht dann am Anfang durch den Görlitzer Park laufen und hat diesen kleinen Kontakt mit den Drogenhändlern, die da ihr Revier einfach haben, und er läuft dann aber so ein bisschen der Wildnis der Stadt entgegen, indem er da im Plänterwald verschwindet und dann in der Spree schwimmt so. Nicht, dass ich in der Spree schwimme, aber ich kenne diese Orte alle und auch die Emotionen, die da so durchfließen, ja, dass man dann in der Warschauer Brücke, in einer Oberbaumbrücke hört man oft so am Freitag dieses Partybassgedröhn und Flaschenklirren und so etwas. Und das habe ich dann sozusagen alles nur übersetzt in diese völlig andere Figur, wie das für sie dann sich anhört.
Kennen Sie Leute, die in der Spree schwimmen?
JG: Ja. Doch, ich kenne eine Frau, die macht Triathlon, also jetzt nicht so diesen ganzen Triathlon, aber den gibt es ja in verkleinerten Formen, und die sagte das, dass man auch in der Spree schwimmt. Also ich bin in einem Kajak diese Strecke, die er schwimmt, runtergepaddelt und dann gegen den Strom wieder hoch und das habe ich schon gemerkt, dass es anstrengend ist, gegen diesen Strom voranzukommen, und dann umso mehr, wenn man selber schwimmt. Es geht – und er macht das ja nachts, da muss man nicht den Ausflugsdampfern oder irgendwelchen Booten, die da einem entgegenkommen, groß ausweichen. Das müsste schon gehen. Aber auch eben wieder etwas, wovon die normalen Leute nichts mitbekommen, weil das einfach außerhalb ihrer Wahrnehmung ist. Die sitzen dann auf diesem Badeschiff und lassen es sich gutgehen, sie ahnen nicht, wer da in der Spree an ihnen vorbeischwimmt.
Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist die Sprache der unterschiedlichen Figuren. Also, der Verkäufer spricht anders als der Redakteur. Machen Sie sich dazu Notizen?
JG: Das ist jetzt nicht so, dass ich bei meinen Figuren denen so Wortfelder zuordne. Das ist es nicht. Ich höre die Leute schon immer gerne reden, wie sie so reden, und ich mag auch die Berliner Weise oder es gibt ja also sehr vielfältige Berliner Mundarten oder so, also dieses türkisch Berlinisch und dann eben das Ostberlinische. Viele dieser Security-Leute sind so ein bisschen Ostberlinisch sozialisiert. Dann ist das so ein Männerberlinisch. Und ich finde, die Sprache kommt dann doch durch die Figuren. Also wenn mir die lebendig vor Augen stehen und die sich im Dialog befinden, dann kommt auch die eigene Sprache. Ja, also ich höre es dann, wenn ich es sehe, oder wenn ich es noch mal nachlese, dann merke ich schon, was stimmt und was irgendwie besser klingen würde so. Wenn ich einfach hier im Café sitze oder im Bus oder so, schreibe ich mir manchmal auch so Sätze auf, also einfach im Notizbuch, weil ich es interessant finde, wie Leute reden. Man kann es aber dann natürlich nicht eins zu eins benutzen so, sondern es muss in diesem Kosmos der Figur einfach vorkommen.
Was ja auch eine große Rolle spielt in dem Buch, das sind so verschiedene Verschwörungstheorien, also Ansätze von Verschwörungstheorien.
JG: So richtig ausgearbeitete Verschwörungstheorien sind meine Sache nicht. Ich habe da so ein gewisses intellektuelles Vergnügen daran, aber als nüchterner Norddeutscher erlahmt dann schnell mein Interesse. In meinem Roman ist es sozusagen diese archaische Form, einen Sündenbock zu finden und irgendwelche Schuldigen dingfest zu machen, indem man sagt: „Die waren es.“ Ja? Wenn man dann erst mal dieser Überzeugung ist, dann kann man ja auch lauter Anzeichen dafür oder Indizien und angebliche Beweise dafür dann sich selber einbilden oder den anderen dazu überreden. Aber in diesen Kommentaren und den Zeitungsartikeln also sind ja nicht nur Hasskommentare, die Leute versuchen irgendwie einen Sinn aus dem zu machen, was die politischen Verhältnisse für uns bedeuten. Und es gehört auch so eine gewisse Rechthaberei dazu, also so eine gewisse Art, sich als schlauer dann zu empfinden als die da oben, ne?
Sie haben ja selbst als Journalist gearbeitet und es wird jetzt ja nicht erst, aber doch vor allem auch seit Trump viel darüber gesprochen, was Journalismus jetzt machen sollte, was er nicht machen sollte. Haben Sie da eine Meinung dazu? Gerade wenn man so diese vielen Hasskommentare sieht oder was da alles kommt, hat Journalismus da eine Verantwortung dazu? Müsste man darauf reagieren? Müsste man diese Foren einfach schließen?
JG: Gute Frage. Also für mich als Journalist habe ich schon sehr stark das Gefühl eines Niedergangs dieser Branche. Als ich den 90ern sozusagen als junger Kerl angefangen habe, für Zeitungen zu schreiben, das war eine großartige Zeit, weil da sich so viel geöffnet hat. Da fiel die Mauer und in ganz Osteuropa fielen da sozusagen die Eisernen Vorhänge und man konnte reisen, man konnte Leute kennenlernen und einfach davon berichten. Und dann gab es diesen frechen Journalismus der Magazine. Das ist in den letzten Jahren immer mehr unter Druck geraten, nicht nur ökonomisch, sondern eben auch politisch. Es ist wirklich in den letzten Jahren erheblich mehr geworden, dass einfach die Legitimation oder Legitimität bezweifelt wird. Oder, ja, das sind dann eben auch so Leute wie Trump, die sagen, das ist alles verlogen. Vielleicht gab es das früher auch, aber nicht in dieser Vehemenz und in dieser Gemeinheit. Und dann gibt es die große Entdeckung des Internets, wo sich sozusagen alle Leute miteinander unterhalten können. Das war ja auch eine großartige Sache, als das aufkam, dass man mit den verschiedensten Leuten irgendwie ins Gespräch kommen konnte. Und ich finde das schon auch schrecklich, wie sich das verkehrt hat in einen Wust von Bösartigkeiten und Gemeinheiten. Unter jeder YouTube-Fernsehdokumentation sind ganze Hasstiraden zu lesen. In den Zeitungen, wo ich gearbeitet habe, werden diese Foren halt noch offengehalten. Ich glaube, die Leute unterhalten sich in vielen Kneipen auch wirklich so, dass sie sagen, die und die haben Schuld und die müssen weg und das Gesocks muss raus. Es gibt ja auch Parteien, die das in anderen Worten, aber einfach auch so fordern. Deswegen glaube ich nicht, dass es viel nutzen würde, da einfach das alles zuzumachen. Aber es ist auch nicht schön zu sehen, dass es immer normaler wird und immer mehr Leute im öffentlichen Diskurs solche doch eigentlich Hassbegriffe übernehmen. Ich brauche es schon, dass ich damit nicht ständig zu tun. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, damit ich einen gewissen Strich ziehen und mal etwas anderes machen kann. Obwohl die Leute natürlich weiterhin da sind.