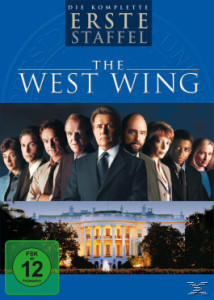Die schönste Überraschung enthält die letzte Folge der Serie „Lilyhammer“: Dort sitzt Ingrid Olava („Oslo, 31. August“) am Klavier und spielt ihr „Back to love“. Ohnehin ist die Musik ein Pluspunkt der Serie, und ihr wurde auf der Blu-ray sogar ein zugebenen kurzer Menüpunkt gewidmet. Aber von der Titelmelodie bis zu den gespielten Liedern sind die gute gemischten jazzigen und poppigen Töne weitaus origineller und einprägsamer als viele Handlungselemente dieser Serie.
Die Geschichte
Nachdem sein Boss gestorben ist und dessen Sohn und Nachfolger ihn umbringen lassen wollte, entscheidet sich Frank Tagliano (Steven Van Zandt) gegen dessen Organisation auszusagen und mithilfe des Zeugenschutzprogramms des FBI ein anderes Leben zu beginnen. Und da ihm seit der Übertragung der Olypmischen Spiele 1994 die norwegische Stadt Lillehammer wie das Paradies auf Erden erscheint, will er dort hin. Also bekommt er mit dem Namen Giovanni „Johnny“ Henriksen eine neue Identität, den guten Rat, nicht bei der Polizei aufzufallen, und geht nach Norwegen. Dort lebt er sich dank seiner alten „Überzeugungsmethoden“ überraschend schnell und kommt mit Erpressungen, Drohungen und vor allem Gefälligkeiten zu einer Kneipe, einem Führerschein, einer schicken Wohnung und schließlich sogar einer hübschen blonden norwegischen Freundin. Nach nur einer Nacht wird sie schwanger – denn wer denkt schon an Verhütung oder Schutz! –und nun scheint er sich endgültig in seinem neuen Dasein eingerichtet zu haben. Aber bald ist ihm ein übereifriger Polizist auf den Fersen und alarmiert durch seine tollpatschigen Nachforschungen auch alte Feinde in den USA.
Ein Amerikaner in Lillehammer
Ein Großteil der Unterhaltung entsteht durch den Zusammenprall der toleranten und liberalen Norweger mit dem knallharten Ex-Mafioso, für den Prügel eine stärkere Waffe als Worte sind. Anfangs sorgen diese Zusammenstöße für durchaus komische Momente, jedoch nutzt sich dieses Konzept ab und schon bald entsteht der Eindruck, die armen Norweger hätten nur auf einen starken Mann gewartet, der ihnen entweder den Mut gibt, selbst durchzugreifen, oder ihnen zeigt, wo es langgeht. Leider wurde auch in der deutschen Version die Serie komplett synchronisiert, während in den USA die norwegischen Teile untertitelt wurden. Und so bleiben nicht nur einige der Gags auf der Strecke, sondern die Einfachheit der Verständigung erstaunt über alle Maßen.
Aber auch im Original ist die Handlung vorhersehbar, außerdem bleiben die Nebenfiguren blass. Polizistin Laila Hovland (Anne Krigsvoll) ist durch ihr Äußeres und schrullig-schroffes Auftreten offensichtlich an Marge Gunderson aus „Fargo“ angelehnt, aber ihr fehlt sowohl Entfaltungsspielraum als auch der grimmige Humor. Johnnys Freund und Geschäftspartner Torgeir (Trond Fausa) ist erschreckend einfach gestrickt, Arbeitsamtsmitarbeiter Jan (Fridtjov Såheim) verspricht einiges, aber er bleibt kleinlaut und widerlich. Erst in der letzten Folge zeichnet sich eine Entwicklung ab, so dass aus seiner Rolle in der zweiten Staffel mehr gemacht werden könnte. Das bleibt auch für Johnnys Freundin Sigrid (Marian Saastad Ottesen) zu hoffen, die bis zur letzten Folge lediglich ein blondes love interest ist, das den Nachtclub, Johnnys plötzlichen Reichtum und seine neuen Freunde mit einem leicht staunend geöffneten Mund und erstaunlicher Naivität hinnimmt. Hier wäre es weitaus unterhaltsamer, wenn sie erkennt, wer er ist – und im Zweifelsfall einfach mitmischt. Und selbst Steve van Zandt greift mit der schiefen Körperhaltung und ‚coolen‘ Sprüchen auf seine Rolle des Silvio Dante aus den „Sopranos“ zurück.
Weder Drama noch Komödie
Insgesamt vertraut die Serie zu sehr darauf, dass die Grundidee eines Mafioso in Norwegen in Verbindung mit Steve van Zandt zwangsläufig eine Mischung aus typischen skandinavischen Krimikomödien und den „Sopranos“ ergeben muss. Einen eigenen Ton sucht man daher vergebens, vielmehr schwankt die Serie zwischen Drama und Komödie. Deshalb hadert Johnny mehr mit der plötzlichen Schwangerschaft seiner Freundin als seiner Situation, kommt es im Zweifelsfall zu einem Gag und nur wenigen bemerkenswerten Momenten. Das ist schade und sorgt dafür, dass „Lilyhammer“ wohl lediglich als erste Netflix-Serie in Erinnerung bleiben wird.