Vor lauter Begeisterung über „The West Wing“ weiß ich fast gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Dialoge! Diese Charaktere! Erwähnte ich schon die Dialoge? Sicherlich gibt es in der ersten Staffel noch viel mehr zu entdecken, als ich beim ersten Sehen wahrgenommen habe. Aber von der ersten Folge an bin ich dieser Serie verfallen – und weiß bereits jetzt, dass ich sie auf jeden Fall noch einmal, zweimal, dreimal sehen werde.
Großartige Charaktere
Vereinfacht gesagt erzählt „The West Wing“ von der Arbeit im Westflügel des Weißen Hauses, dem Teil des Gebäudes, in dem die offiziellen Büros des amerikanischen Präsidenten untergebracht sind. Neben dem Oval Office, dem Cabinet Room, dem Situation Room und dem Roosevelt Room befinden sich dort ebenfalls die Büros der Executive Offices und deren Angestellten. Dazu gehörten in der ersten Staffel von „The West Wing“ Leo McGarry (John Spencer), White House Chief of Staff, ein herrlich knurriger Politstratege der zweiten Reihe, der so ist, wie ich mir Peter Struck immer vorgestellt habe; Josh Lyman (Bradley Whitford), White House Deputy Chief of Staff, scharfzüngig, schlagfertig und romantischer als er zugeben mag; Toby Ziegler (Richard Schiff), White Communications Director, idealistisch, melancholisch, aufbrausend und mein bisheriger Lieblingscharakter; Sam Seaborn (Rob Lowe), Deputy White House Communications Director mit Frauenproblemen und Engagement, C.J. Cregg (Allison Janney), White House Press Secretary, die die Journalistenschar vor allem im Witz im Zaum hält und ein bißchen so ist wie ich gerne wäre; Mandy Hampton (Moira Kelly) als Media Consultant und natürlich Josiah Bartlet (Martin Sheen), Präsident der Vereinigten Staaten, sowie sein Personal Aide Charlie (Dulé Hill). Sie sind die Hauptcharaktere der ersten Staffel, allesamt differenziert und lebendig gezeichnet – einzig Mandy bleibt etwas blass und ist demzufolge im Verlauf der ersten Staffel immer weniger zu sehen.
Politische Hellsichtigkeit
Daneben gibt es eine Vielzahl wiederkehrender Neben- und Gastdarsteller, unter denen insbesondere Donna (Janel Moloney) herausragt, die in der zweiten Staffel auch zum Hauptcast befördert wird. Erstaunlich ist dabei, dass diese Namen beim Lesen oder auch Schreiben fast unübersichtlich erscheinen, in der Serie aber bereits ungefähr nach der Hälfte der ersten Folge völlig selbstverständlich sind (bis auf Charlie, der kommt erst später hinzu). Dazu trägt vor allem bei, dass die Serie einen regelrecht in ihre Welt hineinwirft. Sie setzt ein halbes Jahr nach der Amtseinführung Josiah Bartlets zum Präsidenten in einer Situation ein, in der das Weiße Haus aufgrund der Machtverteilung zwischen Kongress und Senat nicht viel umsetzen kann. Stattdessen müssen die Beteiligten ständig nach Wegen suchen, ihre Ideen doch durchzusetzen. Diese Mehrheitssuche ist oft mühsam, dadurch zeichnet die Serie aber auch ein spannendes Porträt der amerikanischen Politik und ihrer Eigenheiten. Daneben erweist sie sich als bemerkenswert hellsichtig. Beispielsweise geht es in der Folge 9 um die Suche nach dem richtigen Kandidaten für einen frei werdenden Sitz im Supreme Court. Dabei merkt Sam Seaborn an, dass jede Zeit die Gesetze hat, die besonders wichtig sind: „In the ’20s and ’30s it was the role of government. ’50s and ’60s it was civil rights. The next two decades are going to be privacy. I’m talking about the Internet. I’m talking about cell phones. I’m talking about health records and who’s gay and who’s not. And moreover, in a country born on the will to be free, what could be more fundamental than this?“ Das ist heute – 14 Jahren nach Erstausstrahlung der Serie – nur zu unterschreiben.
Clevere Dialoge und Erzählstruktur
Die Handlung entwickelt sich sehr stark über die großartigen Dialoge, bei denen ich hin und wieder vor Begeisterung ausflippen könnte – und es gelegentlich vor dem Fernseher auch tue. Es ist eine Serie, bei der ich lache und weine, applaudiere und mich ärgere. Sicherlich kokettiert die Serie dabei auch mit ihrer eigenen Cleverness, aber es macht Spaß, den Wortduellen zuzuhören. Obwohl „The West Wing“ auch auf einige klischeehafte Szenen nicht verzichtet – gerade in den ersten Folgen beispielsweise Sams ‚Freundschaft‘ mit einer Prostituierten, die Ansprache Bartlets an seine Tochter über Personenschutz und Sicherheit –, ist bemerkenswert, was gerade bei den privaten Geschichten alles nicht gezeigt wird. Wenn beispielsweise Präsidententochter Zoe (Elisabeth Moss) mit Charlie ausgehen will, dann wird das kurz abgehandelt, aber nicht mit großen Szenen ausgewalzt. Wichtige Reden werden vorbereitet, aber das Ereignis nur kurz oder gar nicht gezeigt. Stattdessen legt die Handlung getreu des Mottos von Präsident Bartlets „What’s next“ ein erstaunliches Tempo vor, hat aber dennoch ausreichend Zeit für folgenübergreifende Handlungsstränge. Manchmal liegen sogar mehrere Folgen dazwischen, aber fast alles, was geschieht, hat eine Bedeutung. Dabei nimmt die Serie ab der Mitte der Staffel richtig Fahrt auf – und endet mit einem gemeinen Cliffhanger.
Größter Kritikpunkt nach der ersten Staffel ist für mich daher das Pathos, das am Ende der Folgen und unterwegs immer etwas durchklingt. Aber diese großen Worte auch im kleinen Rahmen charakterisieren einen Präsidenten wohl recht gut. Außerdem ist auch der Gedanke schön, dass zumindest der amerikanische Präsident davon überzeugt ist, trotz aller Probleme im seiner Meinung nach besten Land der Welt zu wohnen. Wenn nicht er, wer dann.
Danksagung
„The West Wing“ stand schon ziemlich lange auf der Liste der Serien, die ich einmal sehen möchte. Aber erst ein Serienstaffelranking im Hirnrekorder-Blog hat mir dann den nötigen Schubs gegeben. Als ich nur die Überschrift las, wusste ich sofort, dass für mich die vierte Staffel von „The Wire“ auf den ersten Platz gehört. Diese Staffel steht auch bei Sebastian am Anfang – und als er mir dann mitteilte, dass für ihn die ersten beiden Staffeln von „The West Wing“ ebenso klar vorne landen mussten, stand mein Entschluss fest, diese Serie nun endlich zu gucken. Danke dafür!

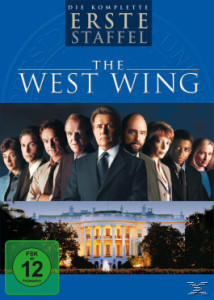
Toll, toll, toll. Das liest sich ja jetzt schon wie eine Liebeserklärung an die Serie – dabei hast du noch viele fantastische Jahre vor dir (insbesondere Staffel 2 und 3).
Der Pathos hat mich in “The West Wing” übrigens nie gestört. Er war irgendwie Teil dieser Welt und hat mich ein wenig verstehen lassen, warum das Weiße Haus und die Politik in Washington, D.C. beinahe schon mythenhaft wirkt. Eine wahrlich fantastische Serie.
Mit der zweiten Staffel bin ich schon fast durch, es fehlen nur noch die letzten drei Folgen. Blöderweise haben mein Mann und ich diese Woche abwechselnd Termine, so dass wir erst morgen weitergucken können. Das sind ganz schön harte Zeiten hier. 😉
Mit dem Pathos kann ich bisher auch gut leben, allerdings gefällt mir grundsätzlich die Hingabe Tobys besser als die großen Worte Bartlets.
Na toll, jetzt will ich das auch sehen.
Ich glaube aber, zwei gefeierte Serien in einem Jahr sind erst mal genug. Nächstes dann. 🙂
Oh ja, mach das!