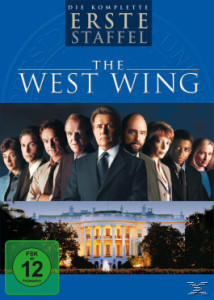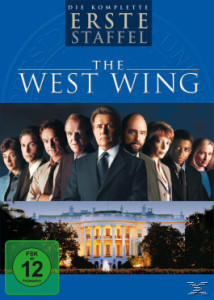
(c) WHV
Eigentlich wollte ich zu jeder Staffel der Serie etwas gebloggt haben. Sobald ich mich aber entscheiden musste, die Serie weiterzugucken oder über sie zu schreiben, entschied ich mich für ersteres. Dann habe ich diesen Beitrag angefangen, nachdem ich alle 154 Folgen der sieben Staffeln von „The West Wing“ gesehen haben. Aber ich habe ihn nie zu meiner Zufriedenheit fertig stellen können – dafür müsste ich wohl alle Folgen noch einmal sehen. Deshalb ist dieser Text mehr ‚work in progress‘, in der ich einige Beobachtungen und Überlegungen festhalte.
Über die Anlage und die Figuren habe ich in meiner Hymne auf die erste Staffel bereits einiges geschrieben, das werde ich hier nicht wiederholen. Auch wird dieser Text – wie sollte es anders sein – einige Spoiler enthalten. Wer die Serie also noch nicht kennt, sollte sie schleunigst nachholen und dann meinen Beitrag lesen. 😉
Erzählstil
Die ersten beiden Staffeln von „The West Wing“ sind großartiges Fernsehen und zeigen sehr deutlich, warum diese Serie als Übergang von den reinen Drama-Serien zu größeren, fortgesetzten Erzählungen heutiger Serien gilt. In fast jeder Folge wird ein politisches Thema behandelt, anfangs sind nur sehr wenige Handlungsstränge folgenübergreifend. Dabei erlauben die Folgen zweierlei: Zum einen werden politische Prozesse erklärt und in der Regel linksliberal interpretiert, zum anderen dienen die jeweiligen Themen der Weiterentwicklung der Figuren. In seinem Beitrag zur Serie hat Sebastian nach einer kompletten Zweitsichtung ausgeführt, dass der „Plot (…) für Sorkin nur das Vehikel (war), um Geschichten über die beteiligten Personen zu erzählen, ihren Charakter genauer zu beleuchten (auch wenn er selbstverständlich gerne den Oberlehrer mimt) und dabei fast immer zweitrangig“ war, steht für mich das Aufklärerische der Folgen etwas mehr im Vordergrund. Aber ich glaube, hier sind wie weniger weit voneinander entfernt als ich anfangs vermutete (vgl. hierzu die Kommentare).
Dieses Prinzip wird dann insbesondere in den mittleren Staffeln aufgeweicht, indem unter anderem mehr persönliche Geschichten erzählt werden. In der sechsten Staffel kommen Handlungsorte außerhalb des Weißen Hauses hinzu, durch die weitere Geschichten ermöglicht werden. Nicht alle waren notwendig – beispielsweise Donnas Verwundung und späterer Abschied –, aber spätestens mit dem Santos-Wahlkampf gewinnt die Serie viele Qualitäten zurück. Weiterhin ist der politische Prozess zwar interessant – selten war in einer Serie mehr über Politik zu lernen –, jedoch geht es weit mehr um den Fortgang der eigentlichen Handlung.
Die siebte Staffel ist von dem Versuch geprägt, das Ende der Amtszeit Bartletts und den Neubeginn mit Santos einzuläuten. Es war eine gute Entscheidung, diesen Wahlkampf zu zeigen, da die Serie in der Mitte des ersten Jahres der Präsidentschaft Bartlett begonnen hat und sich nun mit der siebten Staffel der Kreis gewissermaßen schließt, so dass „The West Wing“ tatsächlich von der Präsidentschaft vom Anfang bis zum Ende erzählt. Zumal es zwischen Santos und Bartlett auch einige Überschneidungen gibt: sie starten beide als Außenseiter und gelten als Idealisten – und wie schnell diese Ideale verloren gehen, hat die Serie hinlänglich gezeigt.
Die Figuren
Gerade am Anfang experimentiert Serienmacher Aaron Sorkin noch mit den Figuren. Präsident Bartlets (Michael Sheen) Präsenz in der Serie nimmt von Folge zu Folge zu, ursprünglich sollte sich die Handlung wohl stärker auf die Mitarbeiter und insbesondere Sam Seaborn (Rob Lowe) konzentrieren. Einige Figuren wie die Beraterin Mandy Hampton (Moira Kelly) verschwinden einfach, ihr Verbleib wird nicht erklärt. Hier wundert es mich schon, warum nicht einfach – wie später mit Ainsley Hayes (Emily Procter) – ein Satz ins Drehbuch geflochten wurde, der diese Abwesenheit erklärt. Meiner Meinung nach erfordert das die Serienfiktion. Besonders ärgerlich ist es beim vorläufigen Ausstieg von Sam Seaborn, der in Kalifornien an Wahlen teilnimmt, deren Ausgang unbekannt bleibt. Nun ist davon auszugehen, dass er die Wahl verloren hat, was er stattdessen macht, wird jedoch erst am Ende der siebten Staffel erklärt.
Im Großen und Ganzen ist es der Serie aber gut gelungen, ausscheidende Figuren mit neuen Charakteren zu kompensieren – zumal auch der Hauptcast weitgehend zusammenbleibt. Zwar steigt der Soap-Charakter mit Verlauf an, jedoch stieg auch meine Anteilnahme an den Figuren – und manchen Figuren habe ich dann ein funktionierendes Privatleben oder wenigstens etwas privates Glück gewünscht. Außerdem ging es in dieser Serie niemals um die Frage „wer mit wem?“, sondern lediglich im Vergleich zu den ersten Staffeln wurden das Privatleben der Figuren wichtiger.
- Will Bailey
Viele Schwierigkeiten der späteren Staffeln lassen sich an Will Bailey festmachen, der Sam Seaborn ersetzen soll. Er wird als brillanter Redenschreiber eingeführt und wird nach einer guten Rede erst Sams vorläufiger Vertreter, dann bekommt er Sams Job, woraufhin alle anderen Angestellten der Redenschreiberei kündigen – was zu einer unsäglichen Folge mit Praktikanten führt – und wird schließlich Head of Communications des Vizepräsidenten. Das ist nicht nur eine steile und nahezu unglaubwürdige Karriere, sondern sie lässt dieser Figur kaum Raum für Entwicklung. Von Anfang an ist er weniger loyal als Sam, jedoch womöglich talentierter. Allerdings können sich die Autoren nicht durchringen, ihm ein eigenes Profil zu verleihen, zumal er durch den veränderten Erzählstil auch weniger Möglichkeiten bekommt.
- Toby Ziegler
Die wohl ärgerlichste Figurenentwicklung durchläuft aber Toby. Er ist der prinzipientreue, moralische Head of Communications, beständig traurig und aufbrausend. Irgendwann in der ersten Staffel bekommt er eine Ex-Frau, später erfahren wir, dass die Ehe vor allem am unerfüllten Kinderwunsch scheiterte. Nun ist seine Ex Andrea aber dennoch schwanger, Toby will die Ehe retten und über zu viele Folgen erstreckt sich diese unsägliche Soap-Geschichte, die wenigstens in einer herzzerreißenden Aussprache mündet. Schließlich wird Toby aber in der siebten Staffel (vermutlich) zum Whistleblower und verrät ein Geheimnis der US-Regierung. Mit viel Mühe wäre diese Entwicklung aufgrund Tobys hoher moralischer Standards noch nachzuvollziehen, wenngleich sie angesichts seiner Treue gegenüber Bartlett schwierig bliebe. Es handelt sich nun aber bei dem verratenen Geheimnis nicht etwa um gefälschte Dokumente über den Uran-Ankauf des Iraks wie bei der anzunehmenden Vorbild-Affäre um Valerie Plame http://de.wikipedia.org/wiki/Valerie_Plame bzw. Lewis Libbyhttp://de.wikipedia.org/wiki/Lewis_Libby geht, die zu einem Krieg geführt haben, sondern um die Existenz eines militärisches Raumschiffs, dass drei Astronauten retten könnte. Als Begründung für Tobys Verhalten werden auch nicht seine ethischen Standards herangezogen, sondern es wird suggeriert, es hänge mit dem Freitod von seinem Bruder zusammen. Das ist bei einer Figur, deren Hingabe zum ‚public service’ so zentral ist, nicht nur unglaubwürdig, sondern unwürdig. (Interessanterweise sieht Schauspieler Richard Schiff das genauso) Daran ändern auch die weiterhin aufrecht erhaltenen Zweifel nicht, Toby könnte sich für eine andere Quelle geopfert haben.
Fazit
Acht Jahre lang erzählt die Serie von den Ereignissen rund um den Westflügel des Weißen Hauses – und sie mutet Figuren wie Zuschauern eine Menge zu. Nicht mit allen Entwicklungen bin ich einverstanden, auch erfordern die fünfte und sechste Staffel aufgrund unsinniger Handlungsideen, zu viel Melodramatik und zu wenig Humor einiges Durchhaltevermögen. Dafür sind aber insbesondere die ersten beiden Staffeln großartiges Fernsehen – und als eine der wenigen Serien gelingt „The West Wing“ ein ordentlicher Abschluss. Gerne würde ich die Serie noch einmal sehen, da es viel mehr zu entdecken gibt. Allein über die Kameraarbeit in den ersten Staffeln könnte ich einen eigenen Beitrag schreiben, von den Dialogen will ich gar nicht erst anfangen. Irgendwann werde ich mir die Zeit für eine Zweitsichtung nehmen – vielleicht im Doppelpack mit „The Wire“.