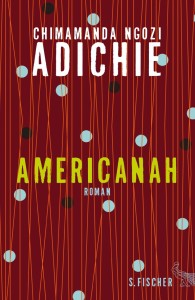Eine Mutter will sich selbst und ihre Kinder töten, indem sie ihre Kinder betäubt und im Winter mit dem Auto in einen abgelegenen See fährt. Doch ihre Tochter Miriam ist kein gewöhnliches zwölfjähriges Mädchen. Sie ist intelligent, hat bereits „begriffen, wie sehr menschliches Glück nicht nur darin bestand, etwas zu erfahren, sondern auch darin, etwas nicht zu erfahren. Zumindest nicht sofort“ und vertraut ihren Eingebungen. Außerdem neigt sie zu einer „gewissen Gesetzestreue“, deshalb ist sie verwundert, dass ihre Mutter ihr im Auto eine Cola reicht. „Denn obgleich sie durchaus das Bedürfnis verspürte, das ganze Jahr über den süßsauren Geschmack dieses aufbrausenden Getränks zu genießen, hatte sie die einmal erfolgte und aus behaupteten Gründen der Vernunft erteilte Beschränkung auf die Urlaubszeit akzeptiert. Hin und wieder aufzumucken gehörte zum Spiel, so wie zum Spiel gehörte, eine Cola auch mal heimlich zu trinken oder sich ungefragt ein Stück Schokolade einzuverleiben. Daß aber die Mutter selbst die Regel durchbrach, ohne dies stichhaltig zu begründen, empfand Miriam als irritierend.“ Folgerichtig trinkt sie die Cola nicht, bemerkt indes, wie wichtig ihrer Mutter ist, dass sie sie zu sich nimmt. Also täuscht sie Schlucke vor, hält aber insgeheim auch ihren jüngeren Bruder Elias davon ab, mehr von seiner Apfelschorle zu trinken. Damit rettet sie ihnen das Leben: Als ihre Mutter in den See fährt, ist Miriam nicht eingeschlafen, sondern kann sich und ihren Bruder ans Ufer retten. Allerdings sind sie nun allein und durchnässt inmitten eines unbekannten Waldes.
In der Folge seziert Heinrich Steinfest in seinem Roman „Das himmlische Kind“ nicht die Tat der Mutter, sondern konzentriert sich auf die Erlebniswelt der Kinder. Sie sind – Hänsel und Gretel gleich – allein im dunklen Wald, doch die findige Miriam entdeckt eine Hütte, in der sie Unterschlupf finden. Es gelingt ihr, ein Feuer anzuzünden, sie stöbert Decken und einige essbare Pilze auf. Als bei ihrem Bruder dann hohes Fieber ausbricht, sorgt sie mit Wadenwickeln, heißem Wasser und vor allem einer symbolhaften Geschichte dafür, dass er am Leben bleibt.
Nachdenken über das Erzählen
Die Erzählperspektive bleibt daher nicht nur dicht bei Miriam, sondern sie wird auch zur Erzählerin ihrer eigenen Geschichte im Roman. Dadurch sind die für Steinfest typischen Reflexionen der Narration möglich, in der sowohl Miriam ihre Rolle als Erzählerin als auch die Bedingungen einer Erzählung im Allgemeinen verhandelt werden. Als sie beispielsweise an einem Punkt in ihrer Geschichte nicht weiterkommt, erzählt sie ihrem Bruder: „Nein, aber weißt Du, einige Sachen in so einer Geschichte stecken im Nebel. Man kann sie nicht sehen. Manchmal wirkt etwas Gerade schief oder umgekehrt. Was Blaues grün. Du verstehst mich, oder? Es gibt eine Wahrheit, aber sie muß aus dem Nebel rauskommen. Oder etwas liegt in der Ferne und man muß erst drauflosgehen, um wirklich sagen zu können, was es ist.“ Und in diesem Nebel findet Miriam schließlich eine wundersame Deutung für ihre Erlebnisse, da sie nicht vermag, ihrem Bruder die Wahrheit zu sagen: dass ihre Mutter sich umgebracht hat. Miriam selbst sagt von sich, sie mache der Mutter keine Vorwürfe: „Es mochte komisch klingen … nein, das tat es nicht: Miriam empfand tiefe Dankbarkeit dafür, daß ihre Mutter sich dagegen entschieden hatte, die inniglich geliebten zwei Kinder bei anderen Menschen unterzubringen. Daß es ihr Plan gewesen war, Miriam und Elias mitsterben zu lassen. Genauso mußte doch eine gute Mutter denken, oder?“ An dieser Überzeugung will – und wird – Miriam ihr ganzes Leben lang festhalten.
Eine allzu weise Heldin
Miriam ist eine ganz und gar ungewöhnliche Heldin, für ihre zwölf Jahre erstaunlich klug und reflektiert, was aber bereits auf den ersten Seiten des Romans angeführt wird. Dennoch erscheint sie mitunter auf eine erwachsene Art zu weise zu sein – gerade auch im Vergleich zu den anderen klugen Kindern in Steinfests Romanen. Dadurch wird manches zu sehr erklärt, Anspielungen und Verweise werden wiederholt, so dass ihre Bedeutung auch in jedem Fall klar wird. Das wäre nicht nötig gewesen, denn es macht den Zauber und Tragik dieses Romans aus, dass manche Ereignisse nicht eindeutig zu erklären sind. Gerade die Welt der Kinder ist in sich stimmig, es sind die Eltern, die weitaus egoistischer sind als vermeintliche Hexen. Ohnehin treten mit dem Einbruch der Erwachsenen in diese geschlossene Welt der Kinder auch im Roman Misstöne auf. Weder der Exkurs über die Frage, ob ein Vater seine Tochter mehr lieben würde, wenn sie schlank wäre, noch manche Überlegungen über die Rolle der Frau sowie politische Korrektheit fügen sich in diese Geschichte ein. Glücklicherweise sind sie jedoch nur kurz.
Kein Kriminal-, sondern nur ein Roman
Insgesamt ist „Das himmlische Kind“ ein zauberhafter Roman, in dem Steinfest-Leser die Tugenden bisheriger Bücher wiederfinden werden – poetische Sprache, scheinbar unerklärliche Wendungen, eine mitunter magische Welt und Gedanken über das Leben und Sterben. Jedoch verzichtet Heinrich Steinfest nun auf die wesentlichen Elemente des Kriminalplots – eine Tat und einen Ermittler – und ein wenig ist seiner Geschichte dadurch die Erdung verloren gegangen. Schon immer waren Heinrich Steinfests Romane auch phantastische Geschichten, jedoch sorgte der Kriminalplot für einen bodenständige Verankerung, die hier mitunter fehlt. Im Gespräch mit CulturMag hat er sich über die Genre-Frage geäußert und ausgeführt, dass er der Gefahr der Wiederholung entgehen wollte. Dieses Ziel hat er sicher erreicht, allerdings bleibt für seinen zweiten Roman „Der Allesforscher“, der im März bei Piper erscheinen wird, auch noch Raum für Verbesserungen.
Heinrich Steinfest: Das himmlische Kind. Droemer/Knaur 2012.