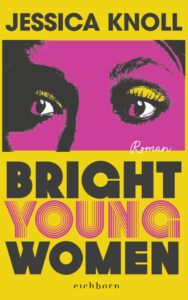Oliver Bottini hat eine Fernsehserie geschrieben: In „Das zweite Attentat“ steht Alex Jaromin im Mittelpunkt, der mit seiner Mutter seit 20 Jahren im Zeugenschutzprogramm des BKA lebt – und herausfinden will, warum sein Vater und seine Schwester 2003 wirklich gestorben sind. Spätestens bei dem Namen Jaromin klingelt es sicherlich bei einigen, denn ja: „Das zweite Attentat“ spielt im selben Kosmos wie Bottinis Roman „Einmal noch sterben“. Seit Anfang April kann man diese Serie in der ARD-Mediathek streamen.
Wer will das denn? Masterclasses von Prominenten liegen voll im Trend – und eigentlich war es da nur eine Frage der Zeit, bis auch Künstliche Intelligenz es aufgreift. Daher kann man sich nun Schreibtipps von Agatha Christie holen.
Recherchen deuten darauf hin, dass Barbara Pym für den MI5 gearbeitet hat – ich würde das gerne als Serie verfilmt sehen.
Sarah Weinman erinnert an Ethel Lina White – eine US-amerikanische Autorin, mittlerweile weithin vergessen. Sie hat u.a. mit „The Wheel Spins“ die Buchvorlage zu Alfred Hitchcocks „The Lady Vanishes“ und mit „Some Must Watch“ die Vorlage zu Robert Siodmaks „The Spiral Staircase“ geschrieben.
Momentan lässt sich in den USA vieles öffentlich beobachten – unter anderem auch, wie versucht, Geschichte umzuschreiben. Abgesehen hat er es unter anderem auf das National Museum of African American History and Culture in Washington D.C. Aber nicht nur in den USA gibt es politische Einflussnahme auf Museen. Wie sie aussieht und welche Ziele sie verfolgen kann, darüber schreibt Felicia Sternfeld, die derzeit Präsident des International Council of Museums in Deutschland ist.
In diesem Zusammenhang: Seit Trumps Wahl wurde insbesondere im englischsprachigen Teil des Internets Timothy Snyders „20 Lessons of Tyranny“ viel geteilt, nun hat sie John Lithgow für ein Video vorgelesen. Auch wenn die Kritikerin in mir sich etwas an der untergelegten Musik stört, hörenswert sind sie natürlich dennoch. Zuletzt wurde über Timothy Snyder zudem vielfach geschrieben, weil er mit seiner Frau Marci Shore die Yale University verlässt und nach Kanada geht. Dazu hat Marci Shore der taz ein Interview gegeben.
Auf ARTE ist derzeit ein sehr kluger Zweiteiler über TikTok zu sehen, der nicht nur erklärt, warum diese App so erfolgreich ist, sondern auch, wie sehr sie die öffentliche Wahrnehmung und Realität bestimmt – selbst für Menschen, die sie nicht nutzen. Dabei schlägt sie den Boden über die Entwicklung des dahinterliegenen Algorithmus und Chinas Überwachung zu Trump und Israel/Gaza. Steckt voller kluger Gedanken und Erklärungsansätze zur Gegenwart!
Wie hat sich eigentlich der linke Widerstand gegen die Nationalsozialisten organisiert? Wie hat man miteinander kommuniziert oder auch Mitstreiter*innen gefunden? Einige Einblicke gibt diese Reportage in der taz.
Dass der Unabomber verhaftet wurde, hat viel mit seinem Bruder zu tun: Er schrieb damals an das FBI, dass sein Bruder der Gesuchte sein könnte. Nach seiner Verhaftung und Verurteilung hat er jahrelang versucht, sich mit seinem Bruder zu versöhnen. In der NYT erzählt er nun davon – und das ist eine interessante Seite eines wahren Verbrechens.
Fritz Honka ist – nicht zuletzt dank Heinz Strunk und Fatih Akin – wohl bundesweit bekannt. Erstaunlich wenig aber weiß man über die Frauen, die er ermordet hat. Nun hat die Historikerin Frauke Steinhäuser angefangen, ihre Biografien zu recherchieren.
Die Künstlerin Daniela Luschin hat mit „Her Last Portrait“ ein Projekt ins Leben gerufen, mit denen sie Opfern von Femiziden ein Gesicht geben will. Weltweit sind Künstlerinnen aufgerufen, sich daran zu beteiligen.
Wer immer bei der taz auf die Idee gekommen ist, Maren Kroymann und Mithu Sanyal zusammenzubringen – ich möchte ihr danken! Oder ihm. Ein tolles Gespräch übers Älter werden, Frausein und Humor.