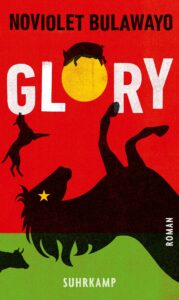Jidada „mit einem da und noch einem da“ ist ein fiktionales Land auf dem afrikanischen Kontinent, das seit über 40 Jahren vom Alten Pferd und seinen Getreuen der Jidada Partei beherrscht wird. Einst haben sie die Unabhängigkeit erkämpft, aber heute ist Jidada durch Korruption, Skrupellosigkeit und Egoismus zu einem der ärmsten Länder des Kontinents geworden. Dürre, Armut und Stromausfälle sind ebenso an der Tagesordnung wie Wahlfälschungen, ethnische Säuberungen und Folterungen. Aber nicht das wird das Alte Pferd stürzen, sondern die Ambitionen seiner Ehefrau, der Eselin Marvellous. Als sie offensichtlich seine Nachfolge anstrebt, haben sein Vize und die Anführer der Defenders -– eine brutale Armee aus bissigen Hunden – genug und setzen ihn mit einen unblutigen Coup ab.
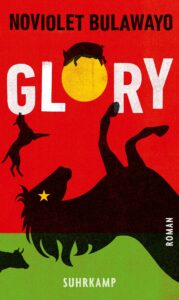
(c) Suhrkamp
Pferde, Esel, Hunde, Katzen, Kühe und Schafe – in ihrer bissigen, zornigen und aufwühlenden Parabel „Glory“ arbeitet die simbabwische Autorin NoViolet Bulawayo mit dem satirischen Mittel des Anthropomorphismus, um von einem korrupten Regime zu erzählen, das deutlich an Simbabwe erinnert. Das Alte Pferd ist Robert Mugabe, sein Nachfolger wird das Pferd Tuvy sein, das immer einen Schal trägt – so wie Mugabes Nachfolger Mnangagwa. Eine kollektive Erzählstimme erzählt vom Ende des Alten Pferdes, der Hoffnung auf eine neue Zeit unter neuer Führung. Dann tritt im zweiten Drittel des Romans eine zentrale Figur zum ersten Mal auf: die Ziege Destiny kehrt nach 10 Jahren im Exil wieder nach Jidada zurück und stellt sich ihren Traumata und denen ihrer Mutter, vor allem die ethnischen Massaker an den Nbebele, die das Alte Pferd und seine Getreuen in den 1980er Jahren anrichten ließ (Gukurahundi). Die Perspektive verschiebt sich noch stärker von den Herrschenden zu den Beherrschten und zu dem hochkomischen, bisweilen ätzenden Spott kommt eine schmerzhafte, fast poetische Erzählung von Leid, wiederholt enttäuschter Hoffnung und einem langsam entstehenden, sehr, sehr kaltem Zorn. Er ist es, der ein hoffnungsvolles Ende erlaubt – aber viel mehr noch macht NoViolet Bulawayo damit deutlich, dass Frauen bzw. „Waipchen“ weder in einem patriarchalen, autoritären Staat noch in einer politischen Satire an den Rand gehören.
Die Vielfalt Bulawayos erzählerischer Register ist beeindruckend: es gibt vordergründige Witze wie der Verweis auf den twitternden Pavian aus den USA, der dort 2018 Präsident ist. Oder Schimpfworte wie „Deckschwester“ für jede Frau, die etwas verlangt. Mit einem Wort wird die Frauenverachtung in Jidada deutlich – und das ist nur ein Beispiel für die gelungene Übersetzung von Jan Schönherr, die die verschiedenen Tonfälle trifft. Sei es die bissige, aber wohltuend komplexe Abrechnung mit dem politischen System. Oder auch die tiefvergrabene Trauer und vielen Traumata angesichts des brutalen Vorgehens der Defenders gegen Demonstranten und Oppositionelle und den Gedanken an die Fünfte Brigade, die in den 1980ern die Ndebele ermordet haben. Dazu verbindet NoViolet Bulawayo gekonnt orale Erzähltraditionen nicht nur mit der politischen Satire, sondern auch mit Social-Media-Narrativen. Das zeigt sich beispielsweise an dem Wort „Tholukuthi“, das beständig wiederholt wird. Es verweist auf das Geschichtenerzählen – es ist ein Ndebele-Wort, das Überraschung ausdrückt – und ist zudem ein Hinweis auf einen Social-Media-Moment: Der Song „Tholukuthi Hey!“ war ein großer Hit zu der Zeit als Mugabe abgesetzt wurde. Auch werden Tweets nicht nur wiedergebeben, sondern es wird auch erzählt, dass es zwei Jidadas gibt: Den realen Ort, das „Land Land“, und das andere Land im Internet, in dem sich die Bewohner von Jidada aufregen, austauschen und mutig Kritik üben. Denn eines zeigt dieses Buch auch sehr deutlich: wie beherrschend die Angst ist in einem Leben in einer Diktatur.
„Glory“ ist ein großer Roman, der weit über die Geschichte Simbabwes, ja, sogar die Geschichte vieler afrikanischer Länder herausreicht. Denn das Versprechen von freien Wahlen und dem Wiederherstellen der „Größe“ von Nationen, die Mechanismen von Genoziden, die Prinzipien von Unterdrückung, ethnischem Hass, Korruption, Ausbeutung und Bereicherung finden sich überall auf der Welt.
NoViolet Bulawayo: Glory. Aus dem Englischen von Jan Schönherr. Suhrkamp Verlag 2023. 464 Seiten. 25 Euro.
Dies ist die längere Textfassung eines Rezensionsgespräches bei DLF Kultur, nachzuhören unter diesem Link.