Leonid McGill ermittelt wieder! In dem vierten Band der Reihe um den New Yorker Privatdetektiv wird Leonid abermals mit den Folgen seines vergangenen Tuns konfrontiert: Vor einigen Jahren hat er geholfen, Zella Grisham mit fingierten Beweisen für einen Raubüberfall ins Gefängnis zu bringen, den sie nicht begangen hat. Doch nun hat er – im Zuge seiner Läuterung – unauffällig für ihre Freilassung gesorgt, ihr eine Wohnung und einen Job besorgt. Doch dummerweise kann er seine Schuldgefühle auf diese Weise nicht loswerden: Ein Anruf der damals bestohlenen Versicherungsfirma kostet Zella Wohnung und Anstellung. Aber nicht nur das: Sie scheint von Unbekannten bedroht zu werden, die ebenso Leonid McGill das Leben schwer machen wollen. Also versucht er herauszufinden, was damals geschehen ist – und muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass er seinen Vater wiederfinden könnte und seine Geliebte Aura Ullman zu ihm zurückkehren möchte.
Souverän erzählt Walter Mosley abermals einen klassischen Fall eines Privatdetektivs, in dem die Ermittlung mindestens genauso wichtig ist wie sein Privatleben. Tatsächlich steht in „Manhattan Fever“ Leonids Familie noch stärker im Zentrum aus in den vorhergehenden Romanen. Dazu trägt natürlich bei, dass mittlerweile einige der ehemals verlorenen Seelen Teil seines Lebens sind: seine Empfangsdame Mardie, seine Söhne, ein Ex-Killer und sein alten Box-Lehrer sind wichtig für ihn. Dabei ist bemerkenswert, dass sie ebensowenig wie Leonid McGill vergessen, woher sie kommen. In Walter Mosleys Romanen kann ein Profikiller zwar in Ruhestand gehen und eine Familie gründen, doch er kann seine Vergangenheit niemals ganz hinter sich lassen. Hier vergisst eine Ex-Prostituierte nicht, was sie bisher über die Welt gelernt hat. Und auch Leonid McGill bleibt allen Anstrengungen zum Trotz der Sohn eines sozialistischen Vaters. Deshalb geht es für ihn auch nicht um sozialen Aufstieg oder gar den amerikanischen Traum; er will einfach nur ein Leben führen, das so friedlich wie möglich ist.
Walter Mosley erzählt facettenreich und voller Details, ohne aber schwatzhaft zu werden. Stattdessen ist allein schon die Eröffnungsszene am Bahnhof unvergesslich – und hier führt Walter Mosley mühelos seine Hauptfigur sowie die Schatten vergangener Taten ein. Von Anfang an wird somit deutlich, dass „Manhattan Fever“ ein Kriminalroman über den Versuch ist, ein anderes Leben zu führen. Mit einem spannenden Fall, sehr guten Charakteren und dem typischen Mosley-Stil ist „Manhattan Fever“ das bisher beste Buch der Reihe.
Walter Mosley: Manhattan Fever. Übersetzt von Kristian Lutze. Suhrkamp 2013.
Zwar werden alle Figuren noch einmal kurz beschrieben, aber allein für die Dynamik innerhalb McGills Familie, die wichtiger als in vielen anderen Kriminalromane ist, empfiehlt sich eine chronologische Lektüre der Reihe:
„Manhattan Karma“
„Falscher Ort, falsche Zeit“
„Bis dass der Tod uns scheidet“

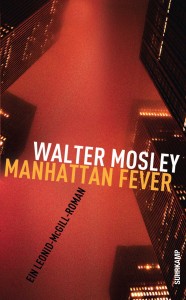
Pingback: 13 Krimis, die ich heuer auch noch lesen wollte | crimenoir